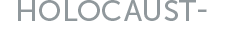Die Kriminalpolizei im NS-Staat
Die Kriminalpolizei (oder Kripo) war im NS-Regime für Ermittlungen in Strafsachen zuständig. Sie untersuchte beispielsweise Verbrechen wie Diebstahl und Mord. Während des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu einer wichtigen Vollstreckungsinstanz der NS-Politik. Die Kripo unterstützte die Verfolgung und Ermordung von Juden und Roma. Sie sorgte auch dafür, dass Menschen, die das NS-Regime als Asoziale, Berufsverbrecher und Homosexuelle einstufte, auf breiter Ebene verhaftet und in Konzentrationslagern inhaftiert wurden.
Wichtige Fakten
-
1
Die NS-Kripo entstand aus kriminalpolizeilichen Einrichtungen, die bereits vor dem NS-Regime überall in Deutschland existierten.
-
2
Der NS-Staat übertrug der Kripo die Befugnis, „rassische, soziale und kriminellen Feinde auszurotten“, indem sie sie auf unbestimmte Zeit in Konzentrationslagern in „Vorbeugungshaft“ nahm.
-
3
Die Kripo war Bestandteil der Sicherheitspolizei und arbeitete eng mit der Gestapo zusammen, der repressiven politischen Polizei des Regimes.
Die Kriminalpolizei (kurz Kripo) war im NS-Staat für strafrechtliche Ermittlungen zuständig. Polizeikräfte mit der Bezeichnung Kriminalpolizei sind im deutschsprachigen Raum auch heute noch üblich.
Die Polizei vor dem NS-Staat
In der Weimarer Republik verfügte jedes deutsche Land über seine eigene Kriminalbehörde. Sie setzten modernste forensische und kriminologische Verfahren ein und waren international anerkannt und etabliert. Ab 1929 traf die Weltwirtschaftskrise auch Deutschland und erschütterte das wirtschaftliche, soziale und politische Leben des Landes. Dies wirkte sich auch auf die Arbeit der Kriminalpolizei aus. In den letzten Jahren der Weimarer Republik waren Kriminalbeamte oft überlastet. Sie fühlten sich für ihre Bemühungen, den neuen gesellschaftlichen Bedingungen adäquat zu begegnen, nicht ausreichend gewürdigt.
Einige dieser Polizeibeamten wandten sich der NSDAP zu. Sie glaubten daran, dass die Nationalsozialisten die vielen sozialen und rechtlichen Probleme lösen würden, die sich so massiv auf ihr berufliches und persönliches Leben auswirkten. Die Nationalsozialisten versprachen, hart gegen Kriminelle vorzugehen. Das Weimarer Strafrechtssystem betrachteten sie als zu nachgiebig und lehnten es daher ab. Sie warfen der Regierung außerdem vor, sie würde es billigen, dass einige Zeitungen durch ihre sensationslüsterne Berichterstattung Kriminelle zu Berühmtheiten machten. Mehrere Berliner Kriminalbeamte identifizierten sich mit diesen Überzeugungen und engagierten sich in der NS-Bewegung.
Machtergreifung der Nationalsozialisten, 1933
Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die neue NS-Regierung hebelte die in der Weimarer Verfassung verankerten Individualrechte aus und erweiterte die Befugnisse der Polizei. Dadurch konnte das NS-Regime die Praxis der Kriminalpolizei ändern. Mit der preußischen Verordnung vom 13. November 1933 wurde die Vorbeugungshaft in einem Konzentrationslager eingeführt. Die Verordnung galt für so genannte Berufsverbrecher. Andere deutsche Staaten schlossen sich dem an. Mit der Verordnung wurde ein lang gehegter Wunsch vieler Kriminalpolizisten und Kriminologen erfüllt. Sie bevollmächtigte die Kriminalpolizei, Personen in Haft zu nehmen, die bereits dreimal wegen vorsätzlicher Straftaten zu mindestens sechs Monaten Haft verurteilt worden waren.
Anfangs war die Anwendung der Vorbeugungshaft begrenzt. Ende 1935 befanden sich 491 angebliche Berufsverbrecher in preußischen Konzentrationslagern. Diese relative Einschränkung währte jedoch nicht lange. Mit der Ausweitung des nationalsozialistischen Polizeistaats radikalisierte sich auch die Politik gegenüber Kriminellen und damit auch die Anwendung der Vorbeugungshaft durch die Kripo.
Verhältnis zwischen Kripo und Gestapo
Unter der Leitung von Reichsführer SS Heinrich Himmler schuf das NS-Regime einen starken, zentralisierten Polizeistaat. Das von Himmler ins Leben gerufene System bestand aus zwei sich ergänzenden Ermittlungspolizeibehörden, deren Beamte in Zivil auftraten: aus der Kripo und der Gestapo. Im Juni 1936 wurden sie in der Sicherheitspolizei (SiPo) zusammengefasst. Die Sicherheitspolizei wurde von Himmlers Stellvertreter Reinhard Heydrich geleitet. Ein Ziel der Zentralisierung war es, beide Polizeibehörden miteinander zu verbinden. Später sollten sie außerdem mit dem SS-Nachrichtendienst, dem Sicherheitsdienst (SD), zusammengelegt werden.
Ab Februar 1938 wurden die Anwärter der Gestapo und der Kripo gemeinsam in den Polizeiakademien ausgebildet. Häufig wechselten die Polizeibeamten zwischen den beiden recht ähnlichen Organisationen. Für die Bevölkerung war es manchmal nicht leicht, zwischen Gestapo- und Kripobeamten zu unterscheiden.
Im September 1939 legte Himmler offiziell die Kripo, die Gestapo und den SD zusammen. Die daraus entstandene neue Behörde war das Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Das RSHA war Reinhard Heydrich unterstellt. Die Kripo wurde zu Amt 5 (Amt V) des RSHA. Bis Juli 1944 wurde die Kripo von Arthur Nebe geleitet. Nebe war langjähriger Kriminalbeamter in Berlin und Nationalsozialist.
Die Kripo umfasste eine Reihe von Sonderdienststellen zur Bekämpfung verschiedener Verbrechen wie Betrug, Einbruchsdiebstahl, Taschendiebstahl, Betäubungsmittelstraftaten und internationalem Menschenhandel. Viele der Dienststellen gab es bereits vor der Zeit des Nationalsozialismus. Es gab aber auch welche, die klar nach NS-ideologischen Kriterien aufgebaut waren. Im Oktober 1936 richtete Himmler ein zusätzliches Organ ein, die sogenannte Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung.
Nationalsozialistische Auslegung von Verbrechen
Unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie theoretisierte und implementierte die Kripo eine rassisch-biologische Auslegung von Verbrechen. Konkret bedeutete dies, dass die Nationalsozialisten Kriminelle als erblich und rassisch degeneriert („entartet“) betrachteten. Die „Rassenhygiene“ der Deutschen sahen sie durch Verbrecher bedroht. Nach Auffassung des NS-Staates und der Kripo mussten Kriminelle folglich zum Schutz der Volksgemeinschaft aus der Gesellschaft entfernt werden.
In einer Rede im August 1939 bezeichnete Reichskriminaldirektor Nebe die Kriminalität als „wiederkehrende Krankheit am Volkskörper“. Diese Krankheit würde angeblich von Kriminellen und „asozialen Menschen“ an ihre Kinder vererbt. Im NS-Staat galten Menschen, die sich aus Sicht der Nationalsozialisten außerhalb der gesellschaftlichen Normen bewegten, als „Asoziale“. Dazu gehörten Vagabunden, Bettler, Prostituierte, Zuhälter und Alkoholiker sowie ,,Arbeitsscheue" und Obdachlose. Auch Roma wurden dieser Kategorie zugeordnet. Das Regime betrachtete Roma als verhaltensauffällig und rassisch minderwertig. Die Definition von Verbrechen als Krankheit und deren Zuordnung zu bestimmten Gruppen radikalisierte die Kripoarbeit.
Radikalisierung der Kripo
Die Kripo akzeptierte die nationalsozialistische Auslegung von Verbrechen. Viele Beamte sahen sich in der Pflicht, gegen Menschen vorzugehen, von denen sie glaubten, sie seien biologisch, rassisch oder erblich zur Kriminalität veranlagt. Im Jahr 1937 erhielten sie durch neue Verordnungen die Befugnis, dies zu tun. Mit diesen Verordnungen wurde die Praxis der Vorbeugungshaft ausgeweitet. Die Kripo war nunmehr befugt, Tausende von Menschen in Konzentrationslagern zu inhaftieren, die nie wegen eines Verbrechens verurteilt worden waren. Unter den Festgenommenen waren auch Personen, die als asozial eingestuft wurden. Die Kripo begründete ihre Maßnahmen mit dem Argument, dass diese Personen oder ihre Nachkommen in Zukunft kriminell werden könnten.
Die Kripo nutzte das Instrument der Vorbeugungshaft auf breiter Ebene. Diese Praxis fiel mit dem Ausbau des Konzentrationslagersystems in den Jahren 1937–1938 zusammen und förderte diesen. Ab 1937 machten die von der Kripo als Berufsverbrecher und Asoziale verhafteten Personen einen Großteil der Lagerinsassen aus. Oft wurden sie anhand der Farben ihres Lagerabzeichens identifiziert. Grün stand für Berufsverbrecher und Schwarz für Asoziale.
Nach 1938 wurden die KZ-Häftlinge entweder von der Kripo in Vorbeugungshaft oder von der Gestapo in Schutzhaft genommen. Keines der beiden Instrumente unterlag einer gerichtlichen Überprüfung. Beide Haftarten hatten zum Ziel, die rassische, politische und soziale Integrität der Volksgemeinschaft zu schützen.
Zwischen 1933 und 1945 schickte die Kripo mehr als 70.000 Menschen in Konzentrationslager. Mindestens die Hälfte dieser Gefangenen starb an den Folgen der Brutalität und Vernachlässigung durch die Nazis.
Kripo, Krieg und Massenmord
Mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 löste Deutschland den Zweiten Weltkrieg aus. Der Krieg entfesselte die Brutalität der Nationalsozialisten und führte schließlich zum Massenmord an Millionen von Menschen.
Während des Krieges wurde die Wehrmacht von der Kripo und verschiedenen anderen Polizeieinheiten unterstützt. Am berüchtigtsten waren die Sicherheitspolizei und der SD, die in den Einsatzgruppen organisiert waren. Dazu gehörten auch Mitglieder der Kripo. Die Einsatzgruppen waren für die Identifizierung und „Neutralisierung“ potenzieller Feinde der deutschen Herrschaft zuständig. Sie waren auch damit beauftragt, wichtige Standorte einzunehmen und Sabotageakte zu verhindern. Des Weiteren rekrutierten sie Kollaborateure und bauten nachrichtendienstliche Netzwerke auf. Zusammen mit anderen SS- und Polizeieinheiten erschossen sie in den Jahren 1939 und 1940 Tausende von Juden und Zehntausende von Angehörigen polnischer Eliten.
Vier Einsatzgruppen waren während des deutsch-sowjetischen Krieges im Einsatz, der im Juni 1941 begann. Arthur Nebe, der Leiter der Kripo, befehligte persönlich eine dieser Einheiten. Von Juni bis November 1941 leitete er die Einsatzgruppe B. Während Nebes Dienstzeit war seine Einheit für den Massenmord an 45.000 Menschen in den Gebieten um Bialystok, Minsk und Mogilev verantwortlich. Viele der Opfer waren Juden.
Kripo und Experimente mit Giftgas
Eine besonders wichtige Dienststelle der Kripo war das Kriminaltechnische Institut der Sicherheitspolizei (KTI). Diese Abteilung bestand aus Forensikern mit wissenschaftlichem und technischem Hintergrund.
Kripobeamte des KTI entwickelten schon früh Techniken zur Massenvergasung von Menschen. Im Oktober 1939 wies Nebe das KTI an, mit Methoden zu experimentieren, die der Tötung von Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen dienen sollten. Diese Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem „Euthanasieprogramm“ durchgeführt. Der KTI-Chemiker und Toxikologieexperte Albert Widmann testete mögliche Tötungsmethoden. Er schlug schließlich Kohlenmonoxidgas vor. Im Herbst 1941 war Widmann an der Entwicklung von Gaswagen beteiligt. In den umfunktionierten Lastwagen wurde Kohlenmonoxidgas aus den Abgasen umgeleitet und zur Tötung von Menschen eingesetzt. Die Planer der Tötungszentren der Operation Reinhard übernahmen diese Methode. In Bełżec, Sobibór und Treblinka wurde das Kohlenmonoxidgas für die Gaskammern von großen Motoren erzeugt.
Neben Massenerschießungen setzten die Einsatzgruppen und andere SS- und Polizeieinheiten Gaswagen ein. Die Gaswagen wurden in dem von den Nazis besetzten Osteuropa zur Ermordung von Juden und Menschen mit Behinderungen eingesetzt.
Verfolgung und Massenmord an Roma

Die Kripo war für die Verfolgung von Roma und den Massenmord an Roma verantwortlich. Sie stützte sich dabei auf ein etabliertes Muster europäischer Polizeikräfte, die diese Gemeinschaft schon lange aufspürten, schikanierten und verfolgten.
1933 gingen die Kripo und andere Polizeibehörden dazu über, die bereits vor dem Nationalsozialismus geltende Gesetzgebung rigoroser gegen Personen durchzusetzen, die sie als ,,Zigeuner" bezeichneten. Die Nationalsozialisten betrachteten „Zigeuner“ als „unerwünschte Rasse“. Im Jahr 1936 richtete Himmler die Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens als Teil der Kripo ein. In den 1930er Jahren richtete die Kripo in einigen Teilen Deutschlands Lager für Roma ein, die auch von ihr verwaltet wurden. Das bekannteste dieser frühen Zigeunerlager war das Lager in Berlin-Marzahn. Während des Krieges weitete die Kripo die Internierung von Roma aus. In der Folge koordinierte sie auch ihre Deportation und Ermordung.
Fazit
Nachdem das NS-Regime 1945 besiegt worden war, versuchten viele Kripobeamte, sich vom NS-Staat und seinen Verbrechen zu distanzieren. Sie gaben vor, kein Unrecht begangen zu haben und machten die Gestapo für die Verbrechen verantwortlich. Ihren Aussagen nach dem Krieg zufolge war die Kripo unpolitisch geblieben. Sie behaupteten, lediglich normale Polizeiarbeit geleistet zu haben, was jedoch eine wissentliche Falschdarstellung der Tatsachen war. Sowohl auf institutioneller als auch individueller Ebene war die Kripo des NS-Regimes maßgeblich an den Verbrechen des Dritten Reichs, einschließlich des Holocaust, beteiligt.