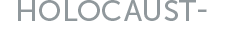Erster Weltkrieg: Verträge und Reparationen
Angesichts der verheerenden Verwüstungen des Ersten Weltkrieges erlegten die westlichen Siegermächte den besiegten Nationen Friedensverträge mit harten Bestimmungen auf. Kraft dieser Verträge wurden den Mittelmächten (Deutschland und Österreich-Ungarn, denen sich später die osmanische Türkei und Bulgarien angeschlossen hatten) große Gebiete aberkannt und erhebliche Reparationszahlungen auferlegt.
Selten zuvor hatte sich die Gestalt Europas so grundlegend verändert. Eine unmittelbare Folge des Krieges war die Auflösung der deutschen, österreichisch-ungarischen, russischen und osmanischen Reiche.
Vertrag von Saint-German-en-Laye
Mit dem Vertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919 wurde die Republik Österreich gegründet. Die Republik umfasste den Großteil der deutschsprachigen Gebiete des ehemaligen Habsburgerreiches. Das österreichische Kaiserreich trat Kronländer an neu gegründete Nachfolgestaaten wie die Tschechoslowakei, Polen und das Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben ab, das 1929 in Jugoslawien umbenannt wurde. Außerdem trat es Südtirol, Triest, Trentino und Istrien an Italien und die Bukowina an Rumänien ab. Ein wichtiger Punkt des Vertrages untersagte es Österreich, seine neu entstandene Unabhängigkeit zu gefährden. Die Bestimmung verbot Österreich die Vereinigung mit Deutschland, ein Ziel, das die „Pan-Germanisten“ seit langem anstrebten und das der in Österreich geborene Adolf Hitler und seine nationalsozialistische Partei aktiv verfolgten.
Die Verträge von Trianon, Sèvres und Lausanne
Der andere Teil der Doppelmonarchie, Ungarn, wurde ebenfalls ein unabhängiger Staat: Gemäß dem Vertrag von Trianon (4. Juni 1920) trat Ungarn Siebenbürgen an Rumänien ab, die Slowakei und die Transkarpatische Rus an die neu gegründete Tschechoslowakei und andere ungarische Kronländer an das zukünftige Jugoslawien. Das Osmanische Reich unterzeichnete am 10. August 1920 den Vertrag von Sèvres, der die Feindseligkeiten mit den alliierten Mächten beendete. Kurz darauf brach jedoch ein türkischer Unabhängigkeitskrieg aus. Die neue türkische Republik, die in der Folgezeit gegründet wurde, unterzeichnete 1923 den Vertrag von Lausanne, mit dem das alte Osmanische Reich aufgelöst wurde.
Woodrow Wilson und sein 14-Punkte-Plan
Im Januar 1918, etwa zehn Monate vor Ende des Ersten Weltkriegs, hatte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson eine Liste mit Vorschlägen für Kriegsziele verfasst, die er als „Vierzehn Punkte“ bezeichnete. Acht dieser Punkte befassten sich speziell mit territorialen und politischen Regelungen im Zusammenhang mit dem Sieg der Entente-Mächte. Dazu gehörte auch der Gedanke der nationalen Selbstbestimmung für ethnische Bevölkerungen in Europa. Die übrigen Grundsätze konzentrierten sich auf die Verhinderung künftiger Kriege, wobei im letzten Grundsatz die Einrichtung eines Völkerbundes zur Schlichtung weiterer internationaler Streitigkeiten vorgeschlagen wurde. Wilson hoffte, dass sein Vorschlag zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen würde, einem „Frieden ohne Sieg“, der „Kriege für alle Zeit beenden“ würde.
Waffenstillstand und Vertrag von Versailles
Als die deutschen Staats- und Regierungschefs den Waffenstillstand unterzeichneten, gingen viele davon aus, dass der 14-Punkte-Plan Wilsons die Grundlage für den künftigen Friedensvertrag bilden würde. Doch als die Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens in Paris zusammentrafen, um die Vertragsbedingungen zu erörtern, hatten die europäischen Vertreter der „großen Vier“ ganz andere Pläne. Da Deutschland die Hauptschuld am Konflikt zugeschrieben wurde, erlegten die europäischen Alliierten dem besiegten Deutschland am Ende besonders strenge vertragliche Verpflichtungen auf.
Der Versailler Vertrag, der den deutschen Unterhändlern am 7. Mai 1919 zur Unterzeichnung vorgelegt wurde, zwang Deutschland zu Gebietsabtretungen an Belgien (Eupen-Malmédy), an die Tschechoslowakei (Bezirk Hultschin) und an Polen (Posen, Westpreußen und Oberschlesien). Elsaß-Lothringen, das 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg annektiert worden war, wurde erneut Frankreich zugeteilt. Alle deutschen Kolonien in Übersee wurden zu Mandatsgebieten des Völkerbundes. Die Stadt Danzig mit ihrer großen ethnisch deutschen Bevölkerung wurde zu einer Freien Stadt.
Der Vertrag sah ferner die Entmilitarisierung und Besetzung des Rheinlands vor sowie einen Sonderstatus für das Saarland unter französischer Kontrolle. Plebiszite sollten über die Zukunft von Gebieten in Nordschleswig an der deutsch-dänischen Grenze und Teilen Oberschlesiens entscheiden.
Der für das besiegte Deutschland vermutlich demütigendste Teil des Vertrages war Artikel 231, der gemeinhin als „Kriegsschuldklausel“ bekannt ist. Mit dieser Klausel wurde Deutschland gezwungen, die volle Verantwortung für die Auslösung des Ersten Weltkriegs zu übernehmen und daher für alle materiellen Schäden aufzukommen. Frankreichs Premierminister Georges Clemenceau bestand auf die Auferlegung enormer Reparationszahlungen. Clemenceau und die Franzosen waren sich zwar bewusst, dass Deutschland wahrscheinlich nicht in der Lage sein würde, derart hohe Zahlungen zu leisten, fürchteten aber dennoch eine rasche Erholung Deutschlands und einen erneuten Krieg gegen Frankreich. Daher versuchten die Franzosen mit dem Vertragssystem, Bemühungen Deutschlands, seine wirtschaftliche Überlegenheit wiederzuerlangen und aufzurüsten, weitestgehend einzuschränken.
Die deutsche Armee wurde auf 100.000 Mann begrenzt, und die Wehrpflicht untersagt. Die Marine wurde per Vertrag auf Schiffe unter 10.000 Tonnen begrenzt, wobei die Anschaffung oder Unterhaltung einer U-Boot-Flotte vollends verboten war. Darüber hinaus durfte Deutschland keine Luftwaffe unterhalten. Deutschland wurde verpflichtet, wegen der Führung eines Angriffskriegs Kriegsverbrecherprozesse gegen den Kaiser und andere Führungspersönlichkeiten zu führen. Die Leipziger Prozesse, bei denen weder der Kaiser noch andere bedeutende Staatsführer auf der Anklagebank saßen, endeten größtenteils mit Freisprüchen und wurden selbst in Deutschland weithin als Farce empfunden.
Auswirkungen des Versailler Vertrags
Die neu gebildete deutsche demokratische Regierung betrachtete den Versailler Vertrag als Diktat. Frankreich hatte höhere materielle Verluste erlitten als die anderen Staaten der „großen Vier“ und bestand deshalb auf harten Bedingungen. Der Friedensvertrag trug letztlich aber nicht dazu bei, die internationalen Streitigkeiten beizulegen, die den Ersten Weltkrieg mit verursacht hatten. Im Gegenteil, er behinderte die innereuropäische Zusammenarbeit und verschärfte die Probleme, die überhaupt erst zum Krieg geführt hatten. Die schrecklichen Opfer, die der Krieg verlangt hatte, und die enormen menschlichen Verluste lasteten sowohl auf der Verliererseite als auch auf der Siegerseite schwer.
Die Bevölkerungen in den besiegten Staaten – Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien – empfanden die jeweiligen Friedensverträge als ungerechte Strafe. Die Regierungen der betroffenen Länder gingen schnell dazu über, die militärischen und finanziellen Bedingungen des Abkommens zu verletzen. Bemühungen, die belastenden Bestimmungen des Friedensvertrags zu revidieren oder zu unterwandern, wurden zu einem Schlüsselelement ihrer jeweiligen Außenpolitik und erwiesen sich als destabilisierendes Element der internationalen Politik. So wurden etwa die Kriegsschuldklausel, die Reparationszahlungen und die militärischen Beschränkungen von den meisten Deutschen als besonders erdrückend empfunden. Forderungen nach der Revision des Versailler Vertrags verschafften daher den rechtsradikalen Parteien in Deutschland, einschließlich Hitlers NSDAP, in den 1920er und frühen 1930er Jahren große Glaubwürdigkeit bei den Wählern.
Das Versprechen, wieder aufzurüsten, deutsches Territorium – insbesondere im Osten – zurückzuerobern, das Rheinland zu remilitarisieren und nach der demütigenden Niederlage und dem diktierten Frieden wieder eine führende Rolle in Europa und weltweit einzunehmen, appellierte an ultranationalistische Gefühle und trug dazu bei, dass Durchschnittswähler die radikaleren Aspekte der NS-Ideologie oft ausblendeten.
Siehe Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs und Aufstieg des Nationalsozialismus, 1918-1933 (externer Link in englischer Sprache).