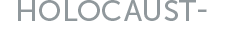Der Erste Weltkrieg
Der Erste Weltkrieg (1914-18) war der erste große internationale Konflikt des 20. Jahrhunderts. Das durch den Krieg bedingte Trauma sollte die Haltungen und Handlungen der politischen Führung und der Zivilbevölkerung während des Holocaust nachhaltig prägen. Die Auswirkungen des Konflikts und das spaltende Friedensabkommen sollten Jahrzehnte später noch nachwirken. Sie begünstigten den Ausbruch eines weiteren Weltkrieges und ebneten letztlich den Weg für einen Völkermord, der unter dem Deckmantel dieses Krieges verübt wurde.
Wichtige Fakten
-
1
Der Erste Weltkrieg war einer der zerstörerischsten Kriege der modernen Geschichte. Mehr als 8,5 Millionen Soldaten verloren infolge der Kampfhandlungen ihr Leben. Dies übersteigt die Zahl der militärischen Todesopfer aller Kriege zusammen, die zwischen den europäischen Mächten im 19. Jahrhundert stattfanden.
-
2
Gegen die besiegten Nationen (Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und die Türkei) wurden empfindliche Strafen verhängt. In den Verträgen wurde diesen Mächten, insbesondere Deutschland, die Schuld am Ausbruch des Krieges zugeschrieben, weshalb sie für die massiven materiellen Schäden haftbar gemacht wurden.
-
3
Mit dem Versailler Vertrag von 1919 wurde Deutschland auferlegt, 13 Prozent seines Territoriums abzutreten und seine Streitkräfte weitgehend aufzulösen. Für viele Deutsche war die durch den Vertrag erlebte Demütigung das Werk der demokratischen Regierung, welche die Monarchie am Ende des Krieges abgelöst hatte.
Ausbruch des Ersten Weltkriegs
Der Erste Weltkrieg war der erste große internationale Konflikt des 20. Jahrhunderts. Auslöser der Feindseligkeiten war die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand, dem Erben der österreichisch-ungarischen Krone, und seiner Frau, Herzogin Sophie, am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Die Kampfhandlungen begannen im August 1914 und wurden in den folgenden vier Jahren auf mehreren Kontinenten fortgesetzt.
Die Alliierten und die Mittelmächte
Die gegnerischen Seiten im Ersten Weltkrieg werden als die Alliierten und die Mittelmächte bezeichnet.
Alliierte:
- Großbritannien
- Frankreich
- Serbien
- Russisches Kaiserreich (auch als russisches Zarenreich bezeichnet)
- Japan
- Später schlossen sich zahlreiche Länder an, darunter Brasilien, Griechenland, Italien, Portugal, Rumänien, Siam (Thailand) und die Vereinigten Staaten.
Mittelmächte:
- Deutschland
- Österreich-Ungarn
- Später kamen das Osmanische Reich (Türkei) und Bulgarien hinzu.
Ausmaß der Kämpfe
Anfangs herrschte auf allen Seiten Kriegsbegeisterung und man war zuversichtlich, dass es schnell zu einem entscheidenden Sieg kommen würde. Die Begeisterung schwand, als der Krieg ins Stocken geriet. Vor allem an der europäischen Westfront entwickelte er sich zu einem Stellungskrieg, der sich durch kostspielige Schlachten und Grabenkämpfe auszeichnete.
Das System der Schützengräben und Befestigungen in Westeuropa erstreckte sich an seiner längsten Stelle auf über 764 km. Es reichte ungefähr von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze. Die meisten nordamerikanischen und westeuropäischen Soldaten erlebten den Krieg als Grabenkrieg.
Die enorme Ausdehnung der Ostfront verhinderte dort einen groß angelegten Grabenkrieg. Dennoch entsprach das Ausmaß des Konflikts dort dem an der Westfront. Auch andernorts in Europa kam es zu schweren Kämpfen: in Norditalien, auf dem Balkan, in Griechenland und in der osmanischen Türkei. Auch in Afrika, Asien, im Nahen Osten und auf den Pazifikinseln, auf See und erstmals auch in der Luft wurde gekämpft.
Auswirkungen des Kriegseintritts der USA und der russischen Revolution
Im April 1917 kam es zu einer entscheidenden Wende. Unter Verweis auf Deutschlands Politik des uneingeschränkten U-Boot-Krieges und auf die Bemühungen des Landes, sich mit Mexiko zu verbünden, erklärten die Vereinigten Staaten Deutschland am 6. April 1917 den Krieg. Neue Truppen und neues Material der American Expeditionary Force (AEF) unter der Führung von General John J. Pershing sowie die verstärkte Blockade deutscher Häfen trugen dazu bei, dass sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Alliierten verschob.
Der gewonnene Vorsprung der Alliierten wurde zunächst durch Ereignisse an der Ostfront wieder ausgeglichen. Im Jahr 1917 wurde Russland, eine der wichtigsten Mächte der Alliierten, von zwei Revolutionen erschüttert. Die erste stürzte die kaiserliche Regierung und die zweite bewirkte die Machtübernahme der Bolschewiki. Beide Ereignisse zusammen werden als Russische Revolution bezeichnet.
Die unmittelbare Auswirkung der Russischen Revolution auf europäischer Ebene war ein brutaler und anhaltender Bürgerkrieg in den ehemals von Russland beherrschten Ländern (1917-1922). Die neue bolschewistische Führung beschloss zudem, einen separaten Friedensvertrag mit den Mittelmächten zu schließen. Dieser Friedensvertrag wurde am 3. März 1918 in Brest-Litowsk (heute Brest, Belarus) unterzeichnet. Der Vertrag legte fest, dass Russland (unter der neuen bolschewistischen Regierung) seine Ansprüche auf Finnland, die Ukraine, Estland und Lettland aufgab. Darüber hinaus verzichtete es auch auf Gebietsansprüche in Polen und Litauen.
Kapitulation der Mittelmächte
Mit dem Vertrag von Brest-Litowsk konnte Deutschland seine Kräfte nun an der Westfront konzentrieren. Ende Juli 1918 standen die Deutschen 80 Kilometer vor Paris, was Kaiser Wilhelm II. dazu veranlasste, der deutschen Bevölkerung zu versichern, der Sieg sei in greifbarer Nähe. Im August jedoch stoppten die Alliierten, die mittlerweile durch zwei Millionen amerikanische Soldaten verstärkt worden waren, die deutsche Offensive und begannen, die deutschen Linien immer weiter zurückzudrängen. Diese Operation wurde als Hunderttageoffensive bekannt.
Die Mittelmächte kapitulierten der Reihe nach, zunächst Bulgarien und das Osmanische Reich im September bzw. Oktober 1918. Am 3. November unterzeichneten die österreichisch-ungarischen Streitkräfte einen Waffenstillstand in der Nähe des italienischen Padua. Ende September teilte die deutsche Militärführung dem Kaiser mit, dass der Krieg verloren sei und legte nahe, dass Deutschland einen Waffenstillstand anstreben solle. Am 4. Oktober bat der deutsche Reichskanzler den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson per Telegramm um die Aufnahme von Friedensverhandlungen mit den Alliierten. Am 8. November entsandte die deutsche Reichsregierung eine Delegation unter der Leitung von Matthias Erzberger nach Frankreich, um dort die Bedingungen der Alliierten für einen Waffenstillstand entgegenzunehmen und zu akzeptieren.
Waffenstillstand
Die Nachricht, dass Deutschland um Frieden ersuchte, war ein Schock für die deutsche Bevölkerung und sorgte für große Unzufriedenheit mit der Regierung. Ende Oktober löste eine Meuterei deutscher Matrosen in Kiel einen Aufstand in den deutschen Küstenstädten sowie in Hannover, Frankfurt am Main und München aus.
Am 9. November 1918 wurde während der allgemeinen Unruhen die Abdankung des Kaiser verkündet. Noch am selben Tag wurde eine deutsche Republik ausgerufen. Zwei Tage später traf Erzberger mit einer Delegation der siegreichen Alliierten unter dem französischen Generalfeldmarschall Ferdinand Foch, dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne zusammen und akzeptierte die Bedingungen des Waffenstillstands. Die Härte der Bedingungen – etwa die Besetzung des Rheinlands durch die Alliierten, die Auslieferung der gesamten deutschen Flotte an die Alliierten und die Fortsetzung der Seeblockade – sollte sich als richtungsweisend für die Bedingungen des Versailler Vertrags erweisen.
Am 11. November 1918 um 11.00 Uhr vormittags wurden die Kämpfe an der Westfront eingestellt. Der „Große Krieg“, wie er von den damaligen Zeitgenossen genannt wurde, war vorbei. Doch die weitreichenden Konsequenzen des Ersten Weltkrieges auf internationaler, politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene sollten noch Jahrzehnte später nachwirken.
Militärische Verluste
Der Erste Weltkrieg war einer der zerstörerischsten Kriege der Geschichte.
Mehr als 8,5 Millionen Soldaten verloren infolge der Kampfhandlungen ihr Leben. Dies übersteigt die Zahl der militärischen Todesopfer aller Kriege, die zwischen den europäischen Mächten im 19. Jahrhundert stattfanden. Wenngleich es schwierig ist, genaue Zahlen zu ermitteln, wurden schätzungsweise 21 Millionen Männer im Kampf verwundet.
Die enormen Verluste auf allen Seiten des Konflikts waren zum Teil auf die Einführung neuer Waffen und militärischer Taktiken zurückzuführen. Dazu gehörten beispielsweise Artillerie mit großer Reichweite, Panzer, Giftgas und Luftangriffe. Die militärischen Befehlshaber versäumten es außerdem, ihre Taktiken an die zunehmend mechanisierte Kriegführung anzupassen. Eine Taktik der Zermürbung, insbesondere an der Westfront, kostete Hunderttausende von Soldaten das Leben.
Der 1. Juli 1916 war der Tag mit den meisten Todesopfern an einem einzigen Tag. An diesem Tag musste allein die britische Armee an der Somme über 57.000 Verluste verzeichnen.
Deutschland und Russland hatten mit 1.773.700 bzw. 1.700.000 Menschen die meisten militärischen Todesopfer zu beklagen. Frankreich verlor sechzehn Prozent seiner mobilisierten Streitkräfte und wies damit die höchste Sterblichkeit im Verhältnis zu den eingesetzten Truppen auf.
Zivile Verluste
Es gab keine offiziellen Stellen, die über die Verluste unter der Zivilbevölkerung in den Kriegsjahren genau Buch führten. Die Geschichtsforschung geht jedoch davon aus, dass bis zu 13.000.000 Nichtkombattanten infolge der Feindseligkeiten starben, hauptsächlich durch Hunger, Krankheit, militärische Aktionen und Massaker. Mit Ausbruch der ,,spanischen Grippe", der tödlichsten Grippeepidemie der Geschichte, stieg die Sterblichkeitsrate gegen Ende des Krieges sowohl in der Militär- als auch in der Zivilbevölkerung sprunghaft an.
Infolge des Konflikts wurden Millionen von Menschen in Europa und Kleinasien zur Flucht gezwungen oder vertrieben. Die materiellen und industriellen Verluste waren katastrophal, insbesondere in Frankreich und Belgien, wo die Kämpfe am heftigsten waren.