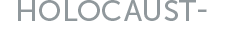Das Kriegsschicksal der Passagiere der St. Louis
Nachdem ihnen der sichere Hafen in Kuba verweigert und ihre Anträge zur Einreise in die Vereinigten Staaten abgelehnt worden waren, gingen die Passagiere der St. Louis in Großbritannien, Frankreich, Belgien oder den Niederlanden von Bord. Das Schicksal der Passagiere in den einzelnen Ländern hing von vielen Faktoren ab, unter anderem von der geografischen Lage des jeweiligen Landes und dem Verlauf des Kriegs gegen Deutschland.
Wichtige Fakten
-
1
In jedem Land waren die Flüchtlinge mit Ungewissheit und finanzieller Not konfrontiert. Anfangs erhielten sie einen befristeten Status und wurden oft zunächst in Flüchtlingslagern untergebracht.
-
2
Die ehemaligen Passagiere machten am Ende ähnliche Erfahrungen wie andere Juden in dem von den Nationalsozialisten besetzten Westeuropa. Viele von ihnen wurden von den Deutschen in Tötungszentren und Konzentrationslagern ermordet. Andere tauchten unter oder überlebten Jahre der Zwangsarbeit. Einige konnten entkommen.
-
3
Von den 620 Passagieren, die auf den Kontinent zurückkehrten, saßen 532 aufgrund der Eroberung Westeuropas durch die Deutschen fest. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen, 278 Menschen, überlebten den Holocaust. 254 Passagiere starben: 84, die sich in Belgien aufgehalten hatten, 84, die in Holland Zuflucht gefunden hatten, und 86, die in Frankreich aufgenommen worden waren.
Rückkehr nach Europa
Im Mai 1940 marschierte die Wehrmacht in Westeuropa ein. Die jüdischen Flüchtlinge, die dem NS-Regime an Bord der St. Louis zunächst entkommen waren und in Frankreich und den Niederlanden Zuflucht gefunden hatten, waren erneut in Gefahr.

Französische, belgische und niederländische Behörden internierten viele Tausend deutsche Flüchtlinge, darunter einige der ehemaligen Passagiere der St. Louis. Die britischen Behörden internierten einige ehemalige Passagiere der St. Louis auf der Isle of Man, andere wurden in Lager nach Kanada und Australien verbracht. Viele der ehemaligen Passagiere, die in Belgien und Frankreich untergekommen waren, wurden in französische Internierungslager gebracht.
Nachdem die französischen Vichy-Behörden mit Deutschland einen Waffenstillstand unterzeichnet hatten, der Frankreich in eine besetzte und eine unbesetzte Zone aufteilte, konnten die Flüchtlinge im unbesetzten Vichy-Frankreich noch legal über Spanien und Portugal in die Vereinigten Staaten oder in andere Länder auswandern. Diese Möglichkeit bestand auch nach Oktober 1941, als die Nationalsozialisten die Auswanderung der Juden aus den von ihnen direkt besetzten Gebieten verboten. Einigen ehemaligen Passagieren der St. Louis gelang die Auswanderung, indem sie auf der US-Einwanderungsliste aufrückten und schließlich an der Reihe waren. Die Organisation einer solchen Reise war jedoch eine bürokratische Herausforderung und kostete viel Zeit und Geld. Wer in die Vereinigten Staaten einreisen wollte, benötigte ein Einwanderungsvisum des amerikanischen Konsulats in Marseille, ein französisches Ausreisevisum und ein Transitvisum für Spanien und Portugal. Transitvisa konnten jedoch nur nach Buchung einer Schiffspassage ab Lissabon erteilt werden. Einigen Flüchtlingen gelang die Auswanderung, darunter sogar einigen der Tausende, die noch in französischen Internierungslagern festgehalten wurden. Doch 1942 versiegten diese letzten Fluchtwege. Zu dem Zeitpunkt begannen die Deutschen, Juden aus Westeuropa in die NS-Tötungszentren im Osten zu deportieren.
So machten einige der ehemaligen Passagiere der St. Louis letztlich ähnliche Erfahrungen wie andere Juden in dem von den Nazis besetzten Westeuropa. Viele von ihnen wurden von den Deutschen in Tötungszentren und Konzentrationslagern ermordet. Andere tauchten unter oder überlebten Jahre der Zwangsarbeit. Einige konnten entkommen. Die unterschiedlichen Schicksale der Familien Seligmann und Hermanns verdeutlichen, wie vielfältig die Erfahrungen der Passagiere waren.
Schicksal der Passagiere
Als die St. Louis nach Europa zurückkehrte, ließ sich die Familie Seligmann (Siegfried, Alma und Tochter Ursula), die ursprünglich aus Ronnenberg in der Nähe von Hannover stammte, in Brüssel nieder, um dort auf ihre US-Visa zu warten. Da sie nicht arbeiten durften, waren sie auf die Unterstützung durch Angehörige und jüdische Flüchtlingsorganisationen angewiesen. Als die Deutschen in Belgien einmarschierten, verhaftete die belgische Polizei Siegfried als „feindlichen Ausländer“ und brachte ihn nach Südfrankreich, wo er im Internierungslager Les Milles festgehalten wurde. Seine Frau und seine Tochter reisten nach Frankreich, um ihn zu finden. In Paris wurden sie von der französischen Polizei verhaftet und in das Internierungslager Gurs gebracht, wo sie harten Bedingungen und Krankheiten ausgesetzt waren. Über das Rote Kreuz erfuhren Alma und Ursula, dass Siegfried in Les Milles interniert war. Im Juli 1941 wurden Alma und Ursula in ein Lager in Marseille verlegt und erhielten von den Vichy-Beamten die Erlaubnis, Einreise- und Transitvisa für die Vereinigten Staaten zu beantragen. Im November verließ die dann wieder vereinte Familie Seligmann Frankreich, reiste durch Spanien und Portugal, verließ Lissabon und kam am 3. Dezember 1941 in New York an. Else, einer weiteren Tochter, war es gelungen, über die Niederlande in die USA einzureisen. Sie erwartete die Familie in Washington, DC, wo sich die Familie dann niederließ.
Der Familie Hermanns erging es nicht so gut. Julius Hermanns, ein Textilkaufmann aus Mönchengladbach, war in Dachau und Buchenwald inhaftiert gewesen. Nach seiner Freilassung buchte er eine Passage auf der St. Louis für sich selbst, konnte sich aber keine Tickets und Genehmigungen für seine Frau Grete und seine Tochter Hilde leisten. Sie blieben in Deutschland. Als die St. Louis nach der Rückkehr aus Kuba in Antwerpen anlegte, reiste Julius nach Frankreich, in der Hoffnung, dass seine Familie dort zu ihm stoßen könnte. Julius wurde jedoch von den Franzosen als „feindlicher Ausländer“ interniert. Im April 1940 wurde er entlassen, aber kurz nach dem Einmarsch der Deutschen erneut verhaftet. Schließlich wurde er nach St.-Cyprien verbracht, einem Internierungslager nahe der spanischen Grenze. Nach seiner weiteren Verlagerung nach Gurs und Les Milles gelang es dem inzwischen erkrankten Julius jedoch nicht, die erforderlichen Einwanderungspapiere und Visa beim amerikanischen Konsulat in Marseille zu erwirken.
Am 11. August 1942 schickten die französischen Behörden Julius mit dem ersten Gefangenentransport von Les Milles in das Durchgangslager Drancy nahe Paris. Drei Tage später deportierten ihn die Deutschen in das Lager Auschwitz-Birkenau, wo er starb. Am 11. Dezember 1941 deportierten die Deutschen Grete und Hilde Hermanns von Deutschland in das Ghetto von Riga in Lettland. Es wird angenommen, dass sie den Krieg überlebt haben.