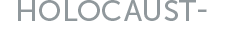Die Reise der St. Louis
Im Mai 1939 machte sich das deutsche Linienschiff St. Louis auf den Weg von Hamburg in das kubanische Havanna. Bei den 937 Passagieren handelte es sich fast ausnahmslos um jüdische Flüchtlinge. Die kubanische Regierung verweigerte dem Schiff jedoch das Anlanden. Die Vereinigten Staaten und Kanada waren ebenfalls nicht bereit, die Passagiere aufzunehmen. Den Passagieren der St. Louis wurde schließlich die Einreise in einige westeuropäische Länder gestattet, sodass sie nicht nach Deutschland zurück mussten. Letztlich kamen 254 Passagiere der St. Louis im Holocaust ums Leben.
Wichtige Fakten
-
1
Nachdem die St. Louis in Havanna angekommen war, erfuhren die Passagiere, dass die kubanische Regierung ihre Einreiseerlaubnisse zurückgezogen hatte. Das American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) verhandelte im Namen der Passagiere mit Kuba, aber die Verhandlungen scheiterten und die kubanische Regierung zwang das Schiff, den Hafen wieder zu verlassen.
-
2
Obwohl das Schiff unweit von der Küste Floridas entlang fuhr, erlaubte die US-Regierung den Passagieren nicht, an Land zu gehen, da sie keine Einreisevisa für die USA besaßen und keiner Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden waren. Die amerikanischen Zeitungen berichteten über das Ereignis und viele Amerikaner sympathisierten mit den Passagieren.
-
3
Bei ihrer Rückkehr nach Europa im Juni 1939 nahmen Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Niederlande jeweils einen Teil der Passagiere auf. Vielen Passagieren gelang es, noch vor dem Einmarsch der Wehrmacht in Westeuropa im Mai 1940 Einwanderungsvisa zu erhalten und in die Vereinigten Staaten auszureisen. 254 der ehemaligen Passagiere kamen im Holocaust ums Leben.

Am 13. Mai 1939 machte sich das deutsche Linienschiff St. Louis auf den Weg von Hamburg in das kubanische Havanna. An Bord befanden sich 937 Passagiere. Fast alle waren Juden, die aus dem Dritten Reich flohen. Die meisten waren deutsche Staatsbürger, einige kamen aus Osteuropa, und einige wenige waren offiziell „staatenlos“. Die meisten der jüdischen Passagiere hatten ein US-Visum beantragt und wollten nur vorübergehend bis zu ihrer Einreise in die Vereinigten Staaten in Kuba bleiben.
Als sich die St. Louis auf See befand, gab es bereits Anzeichen dafür, dass dem Schiff aufgrund der politischen Verhältnisse in Kuba das Anlanden verweigert werden könnte. Das US-Außenministerium in Washington, das US-Konsulat in Havanna, einige jüdische Organisationen und Flüchtlingsorganisationen waren sich der Situation bewusst. Die Passagiere selbst wurden nicht informiert. Die meisten von ihnen mussten schließlich nach Europa zurückkehren.
Vor der Reise
Seit dem Novemberpogrom vom 9. und 10. November 1938 forcierte die NS-Regierung die Zwangsauswanderung von Juden. Das deutsche Auswärtige Amt und das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda setzten darauf, dass ihnen die Zurückhaltung anderer Nationen bei der Aufnahme großer Zahlen jüdischer Flüchtlinge in die Karten spielen würde, um die antijüdischen Ziele und Maßnahmen des NS-Regimes sowohl im Dritten Reich als auch weltweit zu rechtfertigen.
Die Reeder der St. Louis, die Hamburg-Amerika-Linie, wussten bereits vor dem Auslaufen des Schiffes, dass die Passagiere in Kuba Schwierigkeiten bekommen dürften, von Bord zu gehen. Die Passagiere hingegen wussten nicht, dass ihre vom kubanischen Generaldirektor für Einwanderung ausgestellten Landeerlaubnisse und Transitvisa aufgrund eines Dekrets, das nur eine Woche vor Auslaufen des Schiffes vom kubanischen Präsidenten Federico Laredo Bru erlassen wurde, für ungültig erklärt worden waren. Für die Einreise nach Kuba war eine schriftliche Genehmigung des kubanischen Außen- und Arbeitsministers sowie die Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 500 Dollar erforderlich (für US-Touristen wurde die Kaution erlassen).
Feindseligkeit gegenüber Immigranten in Kuba
Die Fahrt der St. Louis fand in den Medien große Aufmerksamkeit. Schon vor dem Auslaufen des Schiffes in Hamburg kritisierten rechtsgerichtete kubanische Zeitungen die bevorstehende Ankunft und forderten die kubanische Regierung auf, keine jüdischen Flüchtlinge mehr aufzunehmen. In der Tat wurden die Passagiere Opfer eines erbitterten Machtkampfes innerhalb der kubanischen Regierung. Der Generaldirektor der kubanischen Einwanderungsbehörde, Manuel Benitez Gonzalez, war wegen des illegalen Verkaufs von Landeerlaubnissen ins Visier der Öffentlichkeit geraten. Er verkaufte diese Dokumente routinemäßig für 150 Dollar oder mehr und hatte so ein persönliches Vermögen von 500.000 bis 1.000.000 Dollar angehäuft. Obwohl er Protegé des Stabschefs der kubanischen Armee (und späteren Präsidenten) Fulgencio Batista war, hatte Benitez' Selbstbereicherung durch Korruption in der kubanischen Regierung so viel Unmut hervorgerufen, dass er zurücktreten musste.
In Kuba ging es jedoch um mehr als Geld, Korruption und interne Machtkämpfe. Genau wie die Vereinigten Staaten und der gesamte amerikanische Kontinent hatte auch Kuba mit der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen. Viele Kubaner missbilligten die Tatsache, dass die Regierung bereits eine relativ große Zahl von Flüchtlingen (darunter 2.500 Juden) ins Land gelassen hatte, weil sie diese als Konkurrenten auf dem angespannten Arbeitsmarkt betrachteten.
Die Feindseligkeit gegenüber Einwanderern schürte sowohl Antisemitismus als auch Fremdenfeindlichkeit. Sowohl die Vertreter des NS-Regimes als auch die lokalen rechtsgerichteten Bewegungen machten in ihren Veröffentlichungen und auf Demonstrationen die Einwanderungspolitik zum Thema und behaupteten, die einreisenden Juden seien Kommunisten. Zwei der Zeitungen – die Diario de la Marina, im Besitz der einflussreichen Familie Rivero, und die Avance, im Besitz der Familie Zayas – hatten den spanischen Faschistenführer General Francisco Franco unterstützt, der nach dreijährigem Bürgerkrieg im Frühjahr 1939 mithilfe des NS-Regimes und des faschistischen Italiens die spanische Republik gestürzt hatte.
Berichte über die bevorstehende Reise der Flüchtlinge lösten in Havanna am 8. Mai, also fünf Tage bevor die St. Louis in See stach, eine groß angelegte antisemitische Demonstration aus. Die Kundgebung, die größte antisemitische Demonstration in der Geschichte Kubas, war vom ehemaligen kubanischen Präsidenten Grau San Martin finanziell unterstützt worden. Grau-Sprecher Primitivo Rodriguez forderte die Kubaner auf, „die Juden zu bekämpfen, bis der letzte vertrieben ist“. Die Demonstration zog 40.000 Schaulustige an. Tausende weitere hörten über Rundfunk zu.
Ankunft der St. Louis in Havanna
Als die St. Louis am 27. Mai im Hafen von Havanna einlief, nahm die kubanische Regierung lediglich 28 Passagiere auf: 22 von ihnen waren Juden und hatten gültige US-Visa. Die übrigen sechs Personen – vier spanische Staatsbürger und zwei kubanische Staatsangehörige – hatten gültige Einreisepapiere. Ein weiterer Passagier wurde in ein Krankenhaus in Havanna evakuiert, nachdem er versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Die übrigen 908 Passagiere (ein Passagier war unterwegs eines natürlichen Todes gestorben) – darunter ein ungarisch-jüdischer Geschäftsmann, der kein Flüchtling war, – hatten auf Einreisevisa gewartet und besaßen lediglich von Gonzalez ausgestellte kubanische Transitvisa. 743 Personen hatten auf ein US-Visum gewartet. Die kubanische Regierung weigerte sich, sie aufzunehmen und ließ die Passagiere nicht von Bord gehen.
Nachdem Kuba den Passagieren der St. Louis die Einreise verweigert hatte, berichtete die europäische und die amerikanische Presse, einschließlich die der USA, über die Ereignisse und machte diese Millionen von Lesern auf der ganzen Welt bekannt. Obwohl die US-amerikanischen Zeitungen im Allgemeinen die Notlage der Passagiere mit großer Anteilnahme schilderten, schlugen nur wenige Journalisten und Redakteure vor, die Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten aufzunehmen.
Am 28. Mai, einen Tag nachdem die St. Louis in Havanna angelegt hatte, traf Lawrence Berenson, ein Anwalt des in den USA ansässigen Jewish Joint Distribution Committee (JDC), in Kuba ein, um im Namen der Passagiere der St. Louis zu verhandeln. Als ehemaliger Präsident der kubanisch-amerikanischen Handelskammer verfügte Berenson über umfassende Geschäftserfahrung in Kuba. Er traf sich mit Präsident Bru, konnte ihn aber nicht davon überzeugen, die Passagiere in Kuba aufzunehmen. Am 2. Juni wies Bru das Schiff an, die kubanischen Gewässer zu verlassen. Während die St. Louis langsam in Richtung Miami segelte, wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Bru bot an, die Passagiere gegen Zahlung einer Kaution von 453.500 $ (500 $ pro Passagier) durch das JDC aufzunehmen. Berenson machte ein Gegenangebot, das Bru jedoch ablehnte. Bru brach die Verhandlungen damit ab.
Wir klammern uns immer an die Hoffnung, dass irgendetwas geschehen wird. Sie werden uns ja nicht einfach dem Ozean überlassen. Ich meine, irgendetwas mussten sie ja mit uns machen. Natürlich war die Angst groß, dass wir nach Deutschland zurückkehren müssen.
Auf der Suche nach Zuflucht
Als sie so nahe an Florida vorbei segelten, dass die Lichter von Miami zu sehen waren, baten einige Passagiere der St. Louis Präsident Franklin D. Roosevelt per Telegramm, ihnen Zuflucht zu gewähren. Roosevelt selbst hat nie darauf geantwortet. Das Außenministerium und das Weiße Haus hatten beschlossen, keine außerordentlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Flüchtlingen die Einreise in die Vereinigten Staaten zu erlauben. In einem Telegramm des Außenministeriums an einen Passagier hieß es, dass die Passagiere abwarten müssten, bis sie auf der Warteliste vorrückten, und dass sie sich für Einwanderungsvisa qualifizieren und diese erhalten müssten, um in die Vereinigten Staaten einreisen zu dürfen. US-Diplomaten in Havanna intervenierten noch einmal bei der kubanischen Regierung und baten darum, die Passagiere aus humanitären Gründen aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg.
Hindernisse bei der Einwanderung in die Vereinigten Staaten
Die im US Immigration and Nationality Act von 1924 festgelegten Quoten regelten strikt die Zahl der Einwanderer, die jedes Jahr in die Vereinigten Staaten einreisen durften. Im Jahr 1939 betrug die jährliche Einwanderungsquote für Deutsche und Österreicher kombiniert 27.370 und war schnell ausgeschöpft. Tatsächlich betrug die Wartezeit auf der Warteliste mehrere Jahre. Die US-Behörden hätten den Passagieren der St. Louis nur zulasten der mehreren Tausend deutscher Juden, die weiter oben auf der Warteliste standen, ein Visum gewähren können. Obwohl die öffentliche Meinung in den USA scheinbar Verständnis für die Not der Flüchtlinge aufbrachte und Hitlers Politik kritisch gegenüberstand, befürwortete sie weiterhin eine Beschränkung der Einwanderung.
Aufgrund der Weltwirtschaftskrise waren auch in den USA Millionen von Menschen arbeitslos und fürchteten die Konkurrenz um die wenigen verfügbaren Arbeitsplätze. Die Krise schürte auch Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Nativismus und Isolationismus. Eine Umfrage des Fortune Magazine zur damaligen Zeit ergab, dass 83 Prozent der Amerikaner gegen eine Lockerung der Einwanderungsbeschränkungen waren. Präsident Roosevelt hätte theoretisch eine Durchführungsverordnung erlassen können, um die Flüchtlinge der St. Louis aufzunehmen. Allerdings hielten ihn die öffentliche Feindseligkeit gegenüber Einwanderern sowie andere politische Erwägungen von diesem Schritt ab. So hatten beispielsweise die isolationistischen Republikaner Sitze bei den Kongresswahlen 1938 gewonnen. Außerdem erwog Roosevelt, für eine bislang nie erreichte dritte Amtszeit als Präsident zu kandidieren.
Roosevelt war nicht der Einzige, der die Stimmungslage im Land nicht mit der Einwanderungsfrage aufs Spiel setzen wollte. Drei Monate bevor die St. Louis in See stach, brachten Senator Robert Wagner (D-N.Y.) und die Abgeordnete Edith Rogers (R-Mass.) ein Gesetz ein, das die Aufnahme von 20.000 deutschen Flüchtlingskindern außerhalb der bestehenden Quote vorgesehen hatte. Nach monatelangen Debatten ließen die Führer des Kongresses das Wagner-Rogers-Gesetz fallen, bevor es überhaupt zur Abstimmung kommen konnte.
Zwei kleinere Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen fuhren im Mai 1939 nach Kuba. Das französische Schiff, die Flandre, hatte 104 Passagiere an Bord, der britische Frachter Orduña 72. Genau wie die St. Louis durften auch diese Schiffe nicht in Kuba anlegen. Die Flandre kehrte zu ihrem Ausgangshafen in Frankreich zurück, während die Orduña eine ganze Reihe lateinamerikanischer Häfen anlief. Die Passagiere gingen schließlich in der von den USA kontrollierten Kanalzone in Panama von Bord. Die meisten von ihnen wurden schließlich von den USA aufgenommen.
Rückkehr nach Europa
Nachdem sich auch die US-Regierung geweigert hatte, die Passagiere an Land gehen zu lassen, segelte die St. Louis am 6. Juni 1939 zurück nach Europa. Die Passagiere kehrten allerdings nicht nach Deutschland zurück. Jüdische Organisationen (insbesondere das Jewish Joint Distribution Committee) verhandelten mit vier europäischen Regierungen, um die Ausstellung von Einreisevisa für die Passagiere zu bewirken:
- Großbritannien nahm 288 Passagiere auf.
- Die Niederlande nahmen 181 Passagiere auf.
- Belgien nahm 214 Passagiere auf.
- 224 Passagiere fanden zumindest vorübergehend Zuflucht in Frankreich.
Von den 288 von Großbritannien aufgenommenen Passagieren überlebten bis auf einen, der 1940 bei einem Luftangriff getötet wurde, alle den Zweiten Weltkrieg. Von den 620 Passagieren, die auf den europäischen Kontinent zurückkehrten, gelang es 87 (14 %), noch vor dem Einmarsch der Deutschen in Westeuropa im Mai 1940 zu emigrieren. Die 532 ehemaligen Passagiere der St. Louis, die nicht rechtzeitig auswandern konnten, saßen in der Falle, als Deutschland Westeuropa eroberte. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen – 278 Menschen – überlebten den Holocaust. Unter den 254 verstorbenen ehemaligen Passagieren befanden sich 84 Personen, die sich in Belgien aufgehalten hatten, 84, die in Holland Zuflucht gefunden hatten, und 86, die in Frankreich aufgenommen worden waren.