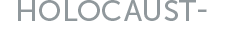Öffentliche Demütigung
Während der zwölf Jahre der NS-Herrschaft (1933–1945) wurden Menschen in Deutschland und in den von den Nazis besetzten Ländern immer wieder öffentlich von NS-Funktionären und -Organisationen gedemütigt. Zielscheibe der Demütigungen waren Juden, aber auch andere Menschen, die angeblich gegen die Rassengesetze verstoßen hatten. Oft wurde jüdischen Männern der Bart abgeschnitten oder sie mussten Körperstrafen über sich ergehen lassen.
Wichtige Fakten
-
1
Die entwürdigenden Handlungen wurden von normalen Bürgern sowie von Polizei, Wehrmacht, SS-Offizieren oder Soldaten vorgenommen. Sowohl Männer als auch Frauen und Kinder waren Zielscheibe von Demütigungen.
-
2
Abgesehen von der Entwürdigung der Opfer lag der Zweck der demütigenden Maßnahmen darin, ihnen die nationalsozialistische Rassenideologie zu indoktrinieren oder Macht zu demonstrieren.
-
3
Demütigungen gehörten zum Alltag unter dem NS-Regime und waren Kernelemente wichtiger Ereignisse, etwa beim ,,Anschluss" oder dem Novemberpogrom.
Hintergrund und Kontext
Demütigung ist eine der stärksten menschlichen Emotionen, die Gefühle von Scham und Erniedrigung hervorruft. Mit der Demütigung einer Person geht einher, dass die Würde dieser Person verletzt wird, indem man ihre grundlegenden Menschenrechte missachtet. Die Demütigungen, welche die Nazis Juden und anderen Opfern zufügten, waren nicht willkürlich, sondern fester Bestandteil ihrer rassistischen Unterdrückung. Demütigungen waren eine Taktik der Nationalsozialisten, mit der nicht nur die Opfer erniedrigt werden sollten, sondern auch der deutschen Bevölkerung und den Bevölkerungen unter NS-Besatzung „Lektionen“ in Sachen Rassenhierarchie erteilt werden sollten. Demütigungen fanden meist öffentlich statt und sollten unter anderem vor „Zuwiderhandlungen“ gegen die Rassengesetze abschrecken. Die Nationalsozialisten wussten sehr wohl, wie wirkungsvoll Demütigungen sein konnten, schließlich hatten viele von ihnen den Vertrag von Versailles 1919 am Ende des Ersten Weltkriegs selbst als nationale Demütigung wahrgenommen.
Mit öffentlichen Demütigungen verfolgten die Nationalsozialisten drei wesentliche Zwecke:
- Das Leid der Opfer sollte verschlimmert werden.
- Die Öffentlichkeit sollte eingeschüchtert und vor den Folgen gewarnt werden, die mit dem Widerstand gegen die NSDAP verbunden waren.
- Durch die Sichtbarkeit der Entwürdigung der Opfer sollte eine kritische Distanz zwischen den Tätern und ihren Opfern geschaffen werden. Indem sich die Nationalsozialisten auf diese Weise von ihren Opfern abgrenzten, fiel es ihnen leichter, all die grausamen Gewalttaten gegen Menschen zu verüben, die ansonsten genau wie sie gewesen wären.
1971 fragte die britische Journalistin Gitta Sereny Franz Stangl, den Kommandanten von Treblinka, nach dem Zweck, der mit der Demütigung der Opfer verfolgt werden sollte: „Wenn sie [die Nazis] sie [die Opfer] doch sowieso töten würden, wozu dann die ganze Demütigung, wozu die Grausamkeit?“ Stangl antwortete: „Um diejenigen zu konditionieren, die diese Maßnahmen am Ende durchführen mussten. Damit sie das tun konnten, was sie getan haben.“
Erniedrigung Einzelner
Viele Demütigungen fanden auf individueller Ebene statt. Dabei wurden eine oder zwei Personen herausgegriffen und wegen angeblicher „Rassenschande“ bestraft. Dies betraf in der Regel Menschen in „gemischtrassigen“ Liebesbeziehungen oder Ehen, etwa zwischen einem „Arier“ und einem „rassisch minderwertigen“ Juden oder Slawen.
Im Jahr 1941 erlangten Beamte im heutigen Ścinawa Nyska (damals Steindorf im deutsch besetzten Schlesien, Polen) Kenntnis von einer Beziehung zwischen einer Polin und einem Deutschen. Bronia (Nachname unbekannt) war eine sechzehnjährige polnische Zwangsarbeiterin, die auf einem Bauernhof im besetzten Polen arbeitete. Der neunzehnjährige Deutsche Gerhard Greschok arbeitete auf demselben Hof. Liebesbeziehungen zwischen Deutschen und Polen waren nach der nationalsozialistischen Rassenpolitik streng verboten. Bronia und Gerhard mussten öffentliche Demütigungen durch lokale Beamte über sich ergehen lassen. Die beiden wurden barfuß durch die Stadt geführt und mussten Schilder mit der Aufschrift „Ich bin ein polnisches Schwein“ (Bronia) und „Ich bin ein Verräter an der Volksgemeinschaft“ (Gerhard) tragen. Ihre Köpfe wurden kahl geschoren. Als Strafmaßnahme wurde Bronia anschließend in ein Konzentrationslager und Gerhard an die Ostfront geschickt.
Auch Juden waren häufig Ziel dieser Art von individueller Demütigung. 1933 wandte sich der jüdische Rechtsanwalt Michael Siegel an die Münchner Polizei, um im Namen seines jüdischen Mandanten Max Uhlfelder Anzeige zu erstatten. Auf dem Polizeirevier wurde Siegel von SS-Angehörigen verprügelt. Anschließend musste Siegel in Begleitung von SA-Leuten barfuß und mit abgeschnittener Hose durch die Straßen Münchens marschieren. Um den Hals trug er ein Schild mit der Aufschrift: „Ich werde mich nie wieder bei der Polizei beschweren.“ Fotos von Siegel, wie er von der SA durch die Straßen gehetzt wurde, erschienen später in amerikanischen Zeitungen.
Andere Formen der Demütigung zielten speziell auf Symbole jüdischer Identität ab. Viele religiöse jüdische Männer trugen Bärte und Schläfenlocken, die ihnen abgeschnitten wurden. Ihre Köpfe wurden rasiert. Andere wurden gezwungen, mit jüdischen Ritualgegenständen wie dem Gebetsschal (Tallitim) oder einer Gebetskapsel (Tefillin) zu posieren oder die Kippa, die traditionelle Kopfbedeckung, abzunehmen. Manchmal wurden Juden dazu gezwungen, sich gegenseitig zu erniedrigen, z. B. indem ein Jude den Bart eines anderen abnehmen musste.
Anschluss und Novemberpogrom

Demütigung war auch ein Kernelement öffentlicher Ereignisse etwa im Rahmen des ,,Anschlusses" oder des Novemberpogroms (auch als Kristallnacht bezeichnet). Im März 1938 annektierte Deutschland Österreich im Zuge eines akribisch inszenierten Ereignisses, das als ,,Anschluss" bekannt wurde. Öffentliche Demütigungen jüdischer Gemeinden Österreichs waren ein wesentlicher Bestandteil des ,,Anschlusses" und sollten die Macht und die Prioritäten des neuen Regimes unterstreichen. In Wien wurden Juden gezwungen, die Straßen auf Händen und Knien zu schrubben, während NS-Beamte und Nachbarn zusahen. Dies wurde während der gesamten Kriegszeit auch in anderen Städten und Dörfern praktiziert, genau wie andere Gruppendemütigungen. In einem anderen Fall zwangen österreichische Nationalsozialisten zwei jüdische Männer, den Schriftzug „Jude“ an der Fassade jüdischer Geschäfte in Wien anzubringen.
Die Demütigung von Juden stand auch bei dem im November 1938 staatlich organisierten Pogrom im Mittelpunkt. Das Pogrom, mit dem die Ausgrenzung und Minderwertigkeit von Juden zur Schau gestellt werden sollte, war ein Akt beispielloser Erniedrigung. Synagogen, jüdische Geschäfte und anderes jüdisches Eigentum wurden vollständig zerstört. Die Angreifer drangen in jüdische Wohnungen ein, nahmen mit, was ihnen gefiel, und zerstörten Besitztümer. In dem auch als ,,Kristallnacht" bezeichneten Pogrom wurden zahlreiche Männer verhaftet, die später deportiert werden sollten. Unter strenger Bewachung mussten sie durch die Straßen ziehen, damit Familienangehörige und Nachbarn Zeuge ihrer Verhaftung wurden.
Institutionelle und systemische Erniedrigung
Demütigungen durchzogen den gesamten NS-Staat und seine Einrichtungen. Durch die Nürnberger Gesetze (1935) und ähnliche antisemitische Gesetzgebung wurden Juden systematisch aus dem täglichen Leben in Deutschland verdrängt. Die Art und Weise dieser Verdrängung sollte Demütigung und Strafe zugleich sein. Juden wurde auferlegt, als visuelles Erkennungszeichen einen Davidstern auf ihrer Kleidung zu tragen. Es wurden Ausgangssperren gegen Juden verhängt und es wurde reglementiert, wann und wo Juden einkaufen und öffentliche Verkehrsmittel benutzen durften. Bänke und andere öffentliche Einrichtungen wurden bestimmten Gruppen zugeordnet. Manche trugen die Aufschrift „Nur für Arier“ oder „Für Juden verboten“ oder waren mit einem „J“ für „Juden“ gekennzeichnet.
Die Zustände in den Ghettos und Lagern waren ohnehin schon demütigend. Überbelegung, Lebensmittelknappheit und katastrophale sanitäre Verhältnisse machten die Bedingungen in den Ghettos unmenschlich und unzumutbar. Hinzukam, dass durch die Lebensumstände im Ghetto gewohnte Familienstrukturen untergraben und herkömmliche Geschlechterrollen aufgehoben wurden. Dies führte oft zu Schamgefühlen bei den Männern und Frauen, weil sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Familien zu versorgen und zu schützen.
In den Konzentrationslagern wurde Erniedrigung noch stärker praktiziert als in den Ghettos. Die dort eingeführten, neuen Formen von Demütigung zielten darauf ab, die Ohnmacht des Einzelnen zusätzlich zu unterstreichen. Die Konzentrationslager waren bewusst darauf ausgerichtet, Menschen ihre Menschlichkeit zu nehmen und Insassen zu entwürdigen, was sie auch effektiv taten. Die Köpfe der Häftlinge wurden rasiert und ihre persönliche Kleidung durch schlecht sitzende Häftlingsuniformen ersetzt. Einigen Insassen wurde die Häftlingsnummer auf den Unterarm tätowiert. Es gab keinerlei Privatsphäre. Lebensmittel waren stark rationiert und die Möglichkeiten zur Körperhygiene begrenzt. Jeder Aspekt des Lebens der Häftlinge wurde kontrolliert, und die Lagerleitung nutzte jede Gelegenheit, die Häftlinge an diese Kontrolle zu erinnern. Diese Praktiken dienten nicht nur dazu, die Häftlinge zu demütigen und zu beschämen. Sie sollten auch die in der Propaganda dargestellte „Minderwertigkeit“ der Inhaftierten visualisieren und genau die Bedrohung erzeugen, die der Nationalsozialismus „auszumerzen“ versprach.
Fußnoten
-
Footnote reference1.
Evelin Lindner. Making Enemies: Humiliation and International Conflict (Westport, CT: Praeger Security International, 2006), xiv-xv.
-
Footnote reference2.
Gitta Sereny. Into That Darkness: An Examination of Conscience (New York: Random House, 1974), 101. Originaltext in Kursivschrift.