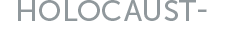![Chart with the title: "Die Nürnberger Gesetze." [Nuremberg Race Laws].](https://encyclopedia.ushmm.org/images/large/423ec6b8-6e77-4854-8f87-41610aa4c747.jpg)
„Arisierung“
Arisierung bezieht sich auf die Übertragung von jüdischem Eigentum an Nichtjuden im nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1933 und 1945. Ziel war es, Wirtschaftsbetriebe in jüdischem Besitz in „arisches“, d. h. nichtjüdisches Eigentum zu überführen.
Es gab zwei Phasen der „Arisierung“:
- die „freiwillige“, noch nicht gesetzlich geregelte ,,Arisierung“ von 1933 bis Sommer 1938
- die „Zwangsarisierung“ von Herbst 1938 bis zum Ende des NS-Regimes 1945
„Freiwillige Arisierung“
Im Rahmen der „freiwilligen Arisierung“ wurden jüdische Geschäftsleute, die wirtschaftlich und sozial bereits diskriminiert wurden, angehalten, ihre Unternehmen zu einem Bruchteil ihres Wertes an Deutsche zu veräußern.

Anfang 1933 gab es in Deutschland etwa 100.000 Geschäfte und Unternehmen in jüdischem Besitz. Etwa die Hälfte davon waren kleine Einzelhandelsgeschäfte, die hauptsächlich mit Kleidung oder Schuhen handelten. Bei den verbleibenden Unternehmen handelte es sich um Fabriken oder Werkstätten unterschiedlicher Größe oder um Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen oder Unternehmen anderer freier Berufe.
1938 war das Geflecht aus NS-Terror, Propaganda, Boykott und Gesetzgebung bereits so wirksam, dass etwa zwei Drittel der jüdischen Unternehmen nicht mehr existierten oder an Nichtjuden verkauft worden waren. Jüdische Eigentümer, die auf eine Auswanderung hofften oder sich von ihrem Unternehmen trennen wollten, akzeptierten zum Teil Verkaufspreise, die lediglich 20 oder 30 Prozent des tatsächlichen Wertes ausmachten.
„Zwangsarisierung“
Unmittelbar nach den gewalttätigen landesweiten Pogromen vom 9. und 10. November 1938 (auch als Kristallnacht bezeichnet) ging die „Arisierung“ in die zweite Phase über: die Zwangsübertragung aller jüdischer Unternehmen an Nichtjuden.
Nach den Novemberpogromen erließ das NS-Regime neue Vorschriften, die Juden die Ausübung der meisten wirtschaftlichen Tätigkeiten untersagten. Das Regime wies jedem noch verbliebenen jüdischen Unternehmen einen nichtjüdischen Treuhänder zu, der den sofortigen Zwangsverkauf an Nichtjuden überwachen sollte. Das Honorar des Treuhänders für seine Dienste lag oft nur geringfügig unter dem Verkaufspreis und wurde von den abtretenden jüdischen Eigentümern bezahlt. Ein Teil der Gewinne aus den Veräußerungen floss in die von Hermann Göring geleitete Vierjahresplanbehörde, mit der die deutsche Wirtschaft auf den Krieg vorbereitet werden sollte.

Die für die Aufnahme einer groß angelegten Rüstungsproduktion erforderlichen Mittel wurden zum Teil durch Beschlagnahmung von jüdischem Eigentum und jüdischer Wertgegenstände aufgebracht. Deutsche Juden, die das Land verlassen wollten, mussten einen Großteil ihres Besitzes aufgeben. Die Reichsregierung erhob eine exorbitante Steuer, die sogenannte „Reichsfluchtsteuer“ von jüdischen Auswanderern.
Nach dem Novemberpogrom verhängte Göring als außerdem eine Geldstrafe von einer Milliarde Reichsmark (RM) gegen die jüdische Bevölkerung. Diese wurde in Form einer direkten Personensteuer erhoben, die jeder jüdische Steuerzahler mit einem Vermögen von mehr als 5.000 RM entrichten musste. Der Staat beschlagnahmte zudem sämtliche Versicherungsleistungen, die jüdischen Eigentümern normalerweise aufgrund der Zerstörungen während des Pogroms zustanden. Stattdessen wurden die Juden selbst für die Schäden verantwortlich gemacht. Kapital, das nach Abzug aller Bußgelder und zusätzlichen Steuern noch übrig war, wurde auf Sperrkonten bei deutschen Banken eingezahlt. Diese Konten unterlagen einer strengen staatlichen Kontrolle. Die Eigentümer selbst konnten nur einen kleinen monatlichen Betrag zur Deckung der Lebenshaltungskosten beziehen.
Während des Kriegs beschlagnahmte das NS-Regime das auf diesen Konten noch verbleibende Vermögen. Persönliche Gegenstände, Immobilien und andere Vermögenswerte der im Rahmen der „Endlösung“ nach Osteuropa deportierten Juden wurden beschlagnahmt und in der Regel versteigert oder an Bombenopfer verteilt, die während der alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städte ihr Eigentum verloren hatten.
Auswirkungen
Über den Gesamtwert des Vermögens, das Juden in Deutschland von den Nationalsozialisten abgenommen worden ist, liegen keine genauen Zahlen vor. Fest steht jedoch, dass Juden, die Deutschland verließen, nur einen Bruchteil ihres Besitzes mitnehmen konnten. Diejenigen, die während des Krieges deportiert wurden, verloren alles; die meisten auch ihr Leben.