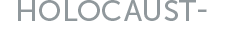Volksgemeinschaft
Ab den 1920er Jahren artikulierten Adolf Hitler und die NSDAP ihr Vorhaben, eine Volksgemeinschaft schaffen zu wollen, die auf den Grundlagen von Rasse, Volkszugehörigkeit und Sozialverhalten beruhen sollte. Nach ihrer Machtübernahme machten sich die Nationalsozialisten daran, eine Volksgemeinschaft im Sinne ihrer ideologischen Ziele zu formen.
Wichtige Fakten
-
1
Ziel der NSDAP war es, das deutsche Volk unter ihrer Führung zu vereinen. Gruppen und Einzelpersonen, die bei den Nazis aus rassischen, biologischen, politischen oder sozialen Gründen als „unerwünscht“ galten, waren ausgeschlossen.
-
2
Denjenigen, die sich der „Volksgemeinschaft“ anschlossen, bot der NS-Staat Anreize. Diejenigen, die als nicht dazugehörig galten, wurden verfolgt.
-
3
Die Maßnahmen der Nationalsozialisten, diese „Volksgemeinschaft“ umzusetzen, machten die Verfolgung und schließlich den systematischen Massenmord an Personen und Gruppen, die von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen waren, einfacher.
Im Jahr 1933 hatten die Nationalsozialisten keinen Plan für die Ermordung der europäischen Juden. Was später als Holocaust bekannt wurde, war das Ergebnis einer Kombination zahlreicher Faktoren und Entscheidungen, die im Laufe der Zeit getroffen wurden. Zu diesen Faktoren gehörten eine extreme Ideologie, Judenhass und Rassismus. In diesem Artikel wird das Konzept der „Volksgemeinschaft“ der NS-Ideologie genauer untersucht.
Einführung
Der Begriff Volksgemeinschaft geht zurück auf das späte 18. bzw. frühe 19. Jahrhundert in Deutschland. Es gab keine genaue Definition für den Begriff. Er wurde auf unterschiedliche Weise angewandt. Zu den Gruppen, die den Begriff übernahmen, gehörten Monarchisten, Konservative, Liberale, Sozialisten sowieoffen rassistische Vereinigungen. Die verschiedenen politischen Parteien und ihre Anhänger verbanden mit dem Begriff oft eine eigene Bedeutung und ein unterschiedliches Ziel.
Ab den 1920er Jahren artikulierten Adolf Hitler und die NSDAP ihr Vorhaben, eine Volksgemeinschaft schaffen zu wollen, die auf den Grundlagen von Rasse, Volkszugehörigkeit und Sozialverhalten beruhen sollte. Nach ihrer Machtübernahme machten sich die Nationalsozialisten daran, eine Volksgemeinschaft im Sinne ihrer ideologischen Ziele zu formen. Ihr Ziel war es, das deutsche Volk unter ihrer Führung zu vereinen. Gruppen und Einzelpersonen, die bei den Nazis aus rassischen, biologischen, politischen oder sozialen Gründen als „unerwünscht“ galten, waren von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Dazu gehörten unter anderem Juden, Schwarze sowie Roma und Sinti, die abwertend als „Zigeuner“ bezeichnet wurden. Ebenfalls ausgeschlossen waren ethnische Deutsche, deren politisches oder soziales Verhalten nicht mit den Überzeugungen des NS-Regimes vereinbar war. Denjenigen, die sich der „Volksgemeinschaft“ anschlossen, bot der NS-Staat Anreize. Diejenigen, die als nicht zugehörig galten, wurden verfolgt.
NS-Propaganda und der Mythos der „Volksgemeinschaft“
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) war eine von vielen rechtsradikalen politischen Parteien, die nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) entstanden. Von Anfang an handelte es sich dabei um eine antisemitische und rassistische Organisation. Sie stand in radikaler Opposition zur neuen deutschen Republik, die nach der Novemberrevolution 1918 gegründet wurde. In ihrem Parteiprogramm von 1920 legte die NSDAP fest: „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf die Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“ Die Nationalsozialisten definierten das jüdische Volk als „fremde Rasse“ aus dem Nahen Osten. Der nationalsozialistischen Ideologie zufolge konnte ein Jude also niemals Deutscher sein oder werden. Dies galt selbst dann, wenn er Deutsch sprach, zum Christentum konvertierte oder seine Familie schon seit Jahrhunderten in Deutschland lebte.
Das Konzept der „Volksgemeinschaft“ in den 1920er und frühen 1930er Jahren

In den 1920er und frühen 1930er Jahren warb die NSDAP um die Stimmen und Unterstützung von Millionen von Deutschen. Ihre Propagandisten setzten dabei vor allem auf Begriffe wie „Volksgemeinschaft“ und „Volksgenosse“. In den letzten Jahren der Weimarer Republik (1918-1933) gelang der NSDAP ein erheblicher Ausbau ihrer Sitze im Reichstag. Im Sommer 1932 war sie die stärkste im Parlament vertretene politische Partei.
Die nationalsozialistische Propaganda stellte die Partei als eine Bewegung dar, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, nationale Größe und Wohlstand wiederherzustellen – womit sie theoretisch alle Deutschen vertrat, unabhängig von Klasse, Region oder (christlicher) Religion. Hitler wies oft darauf hin, dass die NSDAP ein Abbild der „Volksgemeinschaft“ im Kleinen sei, die er sich für die Zukunft vorstelle. Er vertrat die Auffassung, dass die NSDAP aufgrund ihrer breiten Massenbasis die Vorhut der künftigen deutschen „Volksgemeinschaft“ sei. Diese Gemeinschaft würde dann wiederum als Grundlage für einen nationalsozialistischen Staat dienen.
Die Propagandisten stellten den Nationalsozialismus als Bewegung dar, die allen ethnischen Deutschen offenstand. Dieser Gedanke überzeugte viele Deutsche, die – angesichts des Status quo und des Versagens der politischen Führung bei der Bewältigung der aus der Wirtschaftskrise hervorgegangenen Probleme – jede Hoffnung verloren hatten. Hitler versprach, die soziale Harmonie wiederherzustellen, indem er Arbeiter und Angestellte zusammenbringen und Klassenunterschiede und -konflikte beilegen werde. Versprechen wie diese und der Gedanke, Deutschland zu neuer Größe zu verhelfen, fanden bei vielen Anklang.
Am 15. Juli 1932 äußerte sich Hitler dazu in einer Wahlkampfrede:
„Vor 13 Jahren wurden wir Nationalsozialisten verspottet und verhöhnt – heute ist unseren Gegnern das Lachen vergangen!
Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen ist erstanden, die langsam die Vorurteile des Klassenwahnsinns und des Standesdünkels überwinden wird. Eine treue Gemeinschaft von Menschen, die entschlossen ist, den Kampf für die Erhaltung unserer Rasse aufzunehmen, nicht weil es sich um Bayern oder Preußen, Württemberger oder Sachsen, Katholiken oder Protestanten, Arbeiter oder Beamte, Bürger oder Angestellte usw. handelt, sondern weil sie alle Deutsche sind.“
Während ihrer Wahlkampagnen erklärte die NSDAP jedoch nie, wie diese neue „Volksgemeinschaft“ aufgebaut und wer vollständiges Mitglied sein sollte. Und zu welchem Preis.
Das Dritte Reich: Verfolgung als Grundelement der „Volksgemeinschaft“
Nach der Machtübernahme versuchte das NS-Regime, das sich selbst als Drittes Reich bezeichnete, sein Versprechen einzulösen und eine „Volksgemeinschaft“ für alle ethnisch und politisch zuverlässigen Deutschen zu bilden. In der Geschichtswissenschaft ist umstritten, ob und inwieweit es gelungen ist, dieses Ziel zu verwirklichen. Keine Zweifel bestehen jedoch an der Tatsache, dass das Konzept der Volksgemeinschaft eine tragende Säule der NS-Propaganda im Dritten Reich darstellte. Die Volksgemeinschaft sollte eine gespaltene Nation vereinen, indem sie ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Stolzes erzeugte. Gleichzeitig schürte sie Misstrauen, Angst und Hass gegenüber denjenigen, die von ihr ausgeschlossen waren.
Im NS-Staat galten Gruppen wie Juden, Schwarze, Roma und Sinti als „rassisch fremd“. Sie konnten daher auch nicht Teil der „Volksgemeinschaft“ sein. Sie waren Entrechtete und wurden verfolgt. Später wurden Juden, Roma und Sinti Zielgruppen der Vernichtung.
Darüber hinaus wurden unter dem NS-Regime auch Menschen verfolgt, deren politisches oder soziales Verhalten aus Sicht der Nationalsozialisten nicht in die neue „Volksgemeinschaft“ passte. Dies betraf unter anderem politische Gegner, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und „Rassenschänder“. Wenn eine Person deutscher Abstammung ihr Verhalten entsprechend anpasste, konnte sie in die „Volksgemeinschaft“ aufgenommen werden.
Mit ihrer Politik und Gesetzgebung verliehen die Nationalsozialisten der Diskriminierung einen gesetzlichen Rahmen, der es ihnen ermöglichte, bestimmte Gruppen von der „Volksgemeinschaft“ auszuschließen und sie zu Opfern zu machen. Das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 regelte, welche Menschen deutsche Staatsbürger sein konnten: „Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen.“ Diese Klausel machte deutlich, dass die Staatsbürgerschaft kein Recht, sondern ein Privileg war, das von der NS-Führung erteilt wurde. Spätere Verordnungen legten fest, dass Juden, Schwarze sowie Roma und Sinti die deutsche Staatsbürgerschaft nicht erlangen konnten.
Veränderte Konzepte der „Volksgemeinschaft“

Unter dem NS-Regime waren ,,Volksgemeinschaft" und ,,Volksgenosse" dehnbare Begriffe. Die nationalsozialistische Führung konnte sie so auslegen, dass sie geeignet waren, verschiedenste Personengruppen auszuschließen. Deutsche, die weiterhin in jüdischen Geschäften einkauften oder Freundschaften mit jüdischen Nachbarn pflegten, galten als „Volksverräter“. Im Ausland lebenden Deutschen, die sich gegen das Regime aussprachen, wurde oft die Staatsbürgerschaft entzogen. Analog lancierten die Nazis öffentliche Kampagnen gegen so genannte ,,Gemeinschaftsfremde".
Im Dezember 1937 erließ das Regime den Grunderlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Dieser richtete sich gegen so genannte „Asoziale“. Als solche galten Personen, die durch „gemeinschaftswidriges Verhalten“ (auch wenn es nicht kriminell war) zu erkennen gaben, dass sie nicht Teil der Gemeinschaft sein wollten. Diese weit gefasste Definition ermöglichte es der Polizei, etwa 100.000 Personen zu verhaften und zu inhaftieren. Dazu gehörten „Arbeitsscheue“, Landstreicher, Prostituierte und Bettler sowie Roma und Sinti.
Nach 1938 und während der Kriegsjahre wandten die NS-Machthaber diese Politik auch auf ethnische Deutsche an. Das Regime betrachtete nicht automatisch alle Personen deutscher Abstammung als Volksdeutsche, sondern nur diejenigen, die die Politik des neuen Deutschlands unterstützten. Personen deutscher Abstammung, die sich weiterhin als polnische oder sowjetische Staatsbürger betrachteten oder sich „undeutsch“ verhielten, waren von der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen. Während des Zweiten Weltkriegs (1939-1945) wurden Hunderttausende von Menschen deutscher Abstammung von der SS aus den besetzten Gebieten in der Sowjetunion und anderen Regionen in das von Deutschland besetzte Polen gebracht. Die SS führte eine rassische und politische Überprüfung der Neuankömmlinge durch.
Durch den Krieg gelangten Millionen von Nichtdeutschen als Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich. Da Millionen deutscher Männer zum Militärdienst eingezogen worden waren, befürchteten die NS-Behörden, dass der Zustrom von Nichtdeutschen, insbesondere von Slawen, die rassische und ethnische Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung beeinträchtigen könnte. Deutsche Frauen, die sexuelle Beziehungen zu polnischen, sowjetischen oder anderen ausländischen zivilen Zwangsarbeitern oder Kriegsgefangenen unterhielten, oder denen dies vorgeworfen wurde, wurden oft öffentlich gedemütigt und von der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen. Manchmal wurden sie auch in Konzentrationslager verbracht. Die Zwangsarbeiter wurden oft in Konzentrationslagern inhaftiert oder hingerichtet.
Gewinnung der Deutschen für die Volksgemeinschaft
Den Nationalsozialisten ist es zwar nie gelungen, in der Realität eine Volksgemeinschaft zu schaffen, in der Propaganda jedoch schon. Die NS-Propagandisten erhielten klare Anweisungen, wie sie Veranstaltungen zu inszenieren hatten, um den Teilnehmenden das Gefühl zu vermitteln, sie seien Teil einer „Volksgemeinschaft“.
Deutsche Filmemacher und Fotografen porträtierten Heerscharen von Deutschen, die Adolf Hitler begeistert zujubelten. Diese Bilder verliehen dem „Hitler-Mythos“ Glaubwürdigkeit und schufen eine imaginäre Volksgemeinschaft. Die Deutschen wurden ermutigt – und notfalls gezwungen – ihren Arm für den neuen deutschen Gruß zu heben und dabei „Heil Hitler“ zu rufen. Dadurch sollten Deutsche und Ausländer davon überzeugt werden, dass die gesamte Nation hinter dem Regime und seiner Politik stand. Entzog sich jemand dem Ritual, lenkte dies die Aufmerksamkeit auf den Einzelnen. Mit ihrer Verweigerung brachte die betreffende Person zum Ausdruck, dass er oder sie sich nicht als Teil der „Volksgemeinschaft“ betrachtete. Wenngleich die Deutschen die Regierung nicht uneingeschränkt unterstützten, so partizipierten sie in der Regel an derartigen Ritualen, um sich der öffentlichen oder polizeilichen Kontrolle zu entziehen.
Im Kino und in den Wochenschauen vermittelten die NS-Propagandisten der Öffentlichkeit, dass ganz Deutschland hinter dem Führer stand. Leni Riefenstahls Triumph des Willens ist ein Beispiel für die nationalsozialistische Inszenierung der Volksgemeinschaft. So enthält der Film raffinierte Bildmontagen und Aufnahmen von Mitgliedern des deutschen Arbeitsdienstes, die während der Kundgebung der NSDAP in Nürnberg 1934 ihre Heimatregionen ausrufen. Damit sollte gezeigt werden, wie Deutsche, unabhängig von ihrer Region, Klasse oder Religion, gemeinsam ein neues Deutschland aufbauten.
Die NS-Propaganda setzte auch auf andere visuelle Materialien wie Plakate. Bilder von glücklichen deutschen Familien sollten auf eine vielversprechende und intakte Zukunft verweisen. Plakate, auf denen lächelnde Fabrikarbeiter abgebildet waren, sollten soziale Harmonie und das Ende des Klassenkampfs verkörpern.
Privilegien und Ungleichheit
Das Regime stellte der Bevölkerung Privilegien in Aussicht, wenn sie sich an die Normen der Machthaber hielt. So ermöglichte es die Deutsche Arbeitsfront deutschen Arbeitern, ermäßigt Urlaub im In- oder Ausland zu machen. Schiffsreisen nach Norwegen und an andere Orte wurden in Aussicht gestellt. Hitler versprach die Herstellung eines preiswerten Automobils, eines Volkswagens, der für alle erschwinglich sein würde und mit dem die neuen Autobahnen des Landes befahren werden könnten. Viele Deutsche klebten Woche für Woche Marken in ihre „Sparkarten“ – allerdings vergeblich, da das Automobil erst nach dem Krieg in Produktion ging.
Die Propaganda der „Volksgemeinschaft“ überdeckte eklatante Ungleichheiten und Verfolgung in Deutschland. Das Regime fror die Löhne der Arbeitnehmer auf dem Niveau der Wirtschaftskrise von 1932 ein und setzte die Arbeitszeit nach oben. Die Disziplin in den Betrieben wurde verschärft, Streiks wurden verboten. Die Steuern wurden erhöht. Die Verfügbarkeit von Konsumgütern, insbesondere von solchen aus dem Ausland, wurde eingeschränkt. Von den Deutschen wurde erwartet, dass sie sich an den Hilfsprogrammen der Regierung beteiligten. Diese Mittel wurden als individueller Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft dargestellt.
Auswirkungen der „Volksgemeinschaft“
Die Maßnahmen der Nationalsozialisten, die „Volksgemeinschaft“ umzusetzen, machten die Verfolgung und schließlich den systematischen Massenmord an Personen und Gruppen, die von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen waren, einfacher. Ziel der Nationalsozialisten war es, den Hass gegen die europäischen Juden und andere als „Staatsfeinde“ angeprangerte Menschen zu schüren und ein Klima der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer zu schaffen. Viele Deutsche fanden die Zugehörigkeit zu einer „Volksgemeinschaft“ verlockend und waren bereit, die Not der Opfer auszublenden oder zu ignorieren.
Fußnoten
-
Footnote reference1.
Max Domarus, hrsg., Hitler Reden und Proklamationen 1932-1945, Teil I, Triumph, Erster Band 1932-1934, (Leonberg: Pamminger & Partner), 117.