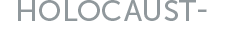Der Holocaust in Odessa
Die ukrainische Stadt Odessa war von Oktober 1941 bis ins Frühjahr 1944 von Rumänien, einem Verbündeten des NS-Regimes, besetzt. Die antisemitische Politik in Odessa führte bald zu Massenmorden. In den ersten Wochen der Besatzung wurden Zehntausende Juden in der Stadt Odessa und ihren Vororten von den rumänischen Besatzern ermordet. Anschließend wurden die überlebenden Juden aus der Stadt deportiert. Die meisten von ihnen wurden Ende 1941 und in der ersten Hälfte des Jahres 1942 in den von Rumänien besetzten Gebieten getötet.
Wichtige Fakten
-
1
Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges machten die Juden ein Drittel der multiethnischen Bevölkerung von Odessa aus, wo etwa 600.000 Menschen lebten.
-
2
Odessa wurde am 16. Oktober 1941 von rumänischen Behörden besetzt. Dort angekommen, begannen die Besatzer sofort, die jüdische Bevölkerung ins Visier zu nehmen. Die in Odessa lebenden Juden waren Misshandlungen, Gewalttaten, Inhaftierungen, Zwangsarbeit, Deportationen und Massentötungen ausgesetzt.
-
3
Innerhalb eines Jahres nach Beginn der Besetzung von Odessa war die jüdische Gemeinde aus der Vorkriegszeit weitestgehend vernichtet.
Der Holocaust in Odessa begann nach der Besetzung der Stadt am 16. Oktober 1941 durch deutsche und rumänische Soldaten. In Odessa und anderen Teilen der von Rumänien besetzten Ukraine nahm die judenfeindliche Politik der Besatzer schnell chaotische Ausmaße an. An den Massenmorden an der jüdischen Bevölkerung in Odessa waren verschiedene Gruppen beteiligt. Darunter waren Rumänen, Deutsche und einheimische Kollaborateure (einschließlich Russen, Ukrainer und vor allem Deutsche, die in Odessa lebten und einen bedeutenden Teil der Bevölkerung ausmachten).
Weniger als eine Woche nach Beginn der Besetzung verübten die rumänischen Behörden ein Massaker, bei dem mindestens 25.000 bis 30.000 Juden in Odessa und den umliegenden Vororten brutal zu Tode kamen. Das Massaker dauerte mehrere Tage an. Bald darauf zwangen die Rumänen etwa 25.000 bis 30.000 Juden zu einem Todesmarsch von Odessa in ein Lager im Dorf Bohdaniwka (rumänisch: Bogdanowka). Fast alle diese Juden wurden innerhalb von sechs bis acht Wochen nach ihrer Ankunft im Lager getötet.
Im Dezember 1941 beschlossen die rumänischen Behörden, Odessa „judenfrei“ zu machen. In der ersten Hälfte des Jahres 1942 wurden die in Odessa verbliebenen Juden in ländlich gelegene Inhaftierungsstätten deportiert. Die meisten von ihnen wurden dort bei Massenerschießungen ermordet. In weniger als einem Jahr wurde die einst so lebendige jüdische Gemeinde von Odessa fast vollständig vernichtet.
Nur wenige von ihnen überlebten den Holocaust in Odessa, entweder als Zwangsarbeiter oder indem sie sich im Verborgenen hielten.
Die jüdische Gemeinde von Odessa vor dem Zweiten Weltkrieg
Die jüdische Gemeinde von Odessa durchlebte in den Jahrzehnten vor dem Holocaust einen großen Wandel.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebte in der Hafenstadt eine der größten und lebendigsten jüdischen Gemeinden in Osteuropa. Odessa war ein namhaftes Zentrum jüdischer Kultur und Bildung.
Seit der Gründung der Stadt im späten 18. Jahrhundert machten Juden einen bedeutenden Teil der vielfältigen Bevölkerung von Odessa aus. Odessa war eine der wenigen größeren Städte im Russischen Reich, in denen Juden leben durften. Doch wie alle Juden im Russischen Reich waren auch die Juden in Odessa Einschränkungen unterworfen. Auf Anordnung der kaiserlichen Behörden hatten Juden nur beschränkt Zugang zu Schulen und Universitäten. Diese Einschränkungen wirkten sich auch darauf aus, welche Berufe Juden ausüben konnten. Die jüdische Bevölkerung war antisemitischer Gewalt, darunter auch Pogromen, ausgesetzt.
Das Leben der Juden in Odessa änderte sich nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches im Jahr 1917 und der Gründung der Sowjetunion im Jahr 1922 drastisch. Die sowjetische Diktatur übte eine strenge Kontrolle über ihre Bevölkerung aus. Durch diese Kontrolle waren Ausbrüche interethnischer Gewalt wie Pogrome gegen Juden eine Seltenheit. Als kommunistischer Staat setzte das sowjetische Regime eine Politik um, bei der Menschen auf Grundlage ihres sozialen und wirtschaftlichen Status verfolgt wurden. Diese Politik galt für alle sowjetischen Bürger, also auch für Juden. Das Sowjetregime nahm wohlhabendere Menschen als sogenannte Klassenfeinde ins Visier und konfiszierte ihre Häuser und Geschäfte. Diese Politik führte zu neuen Möglichkeiten für ärmere Menschen. Vor allem Juden hatten nun Zugang zu Bildungs- und Karrierewegen, die ihnen zuvor verwehrt waren. Unabhängig von ihrem sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund waren jedoch alle sowjetischen Bürger – einschließlich Juden – der Verfolgung und sogar Ermordung durch das Regime ausgesetzt, wenn sie als Regimefeinde wahrgenommen wurden oder sich tatsächlich gegen das Regime richteten.
Die sowjetische Politik belastete alle ethnischen, nationalen und religiösen Gemeinschaften; so auch die jüdische Gemeinde von Odessa. In Anlehnung an kommunistische Grundsätze schlossen die sowjetischen Behörden viele religiöse Einrichtungen. Für Juden bedeutete das, dass die meisten Synagogen und religiösen Schulen geschlossen wurden und Rabbiner ins Visier des Regimes gerieten. Auch unabhängige kulturelle und soziale Organisationen waren den Sowjets verdächtig. Infolgedessen wurden viele jüdische Einrichtungen, darunter jiddischsprachige Bibliotheken, Theater und Verlage, geschlossen. Das jüdische Gemeindeleben in Odessa kam in den 1930er Jahren nahezu zum Stillstand. Und das, obwohl es immer noch eine große jüdische Präsenz in der Stadt gab. Diese Art der Politik hatte ähnliche Auswirkungen auf andere ethnische und nationale Gruppen.
Laut der sowjetischen Volkszählung von 1939 waren etwa ein Drittel (ca. 200.000) der Einwohner Odessas Juden.
Odessa im Zweiten Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg begann in Europa im September 1939, erreichte Odessa aber erst fast zwei Jahre später. Am 22. Juni 1941 griffen das NS-Regime und seine Achsenverbündeten, darunter auch Rumänien, die Sowjetunion an. Diese Militäraktion trug den Decknamen „Unternehmen Barbarossa“.

Eines der ersten Anzeichen des Krieges in Odessa war die Ankunft von Flüchtlingen aus Bessarabien. Unter ihnen waren auch Juden. Im Rahmen des Unternehmens Barbarossa stießen rumänische und deutsche Truppen rasch in die Regionen Bessarabien und Nordbukowina vor. Diese Regionen waren in der Zwischenkriegszeit Teil von Rumänien und im Juni 1940 zwangsweise an die Sowjetunion abgetreten worden. Nach Beginn des Unternehmens Barbarossa wurden die Gebiete von Rumänien rasch wieder eingegliedert. In Bessarabien war die jüdische Bevölkerung nahezu sofort diskriminierenden Maßnahmen, Ghettoisierung, Deportationen und Massenmorden durch die rumänischen Behörden ausgesetzt. Dies veranlasste viele bessarabische Juden dazu, nach Osten zu fliehen. Einige gingen nach Odessa, bevor die Deutschen und Rumänen sich auf die Einnahme der Stadt konzentrierten.
Anfang August 1941 hatten die Achsenmächte Odessa vollständig eingekesselt. Rumänische Truppen belagerten die Stadt. Die Rote Armee (das sowjetische Militär) verteidigte die Stadt noch mehr als zwei Monate lang.
Odessa wurde am 16. Oktober 1941 von den Rumänen besetzt. Sie ernannten sie zur Hauptstadt des Gouvernements Transnistrien. Das Gouvernement Transnistrien war eine rumänische Verwaltungseinheit des besetzten Gebietes zwischen den Flüssen Dnjestr und Südlicher Bug, das zuvor zur Sowjetukraine gehörte. Das Gouvernement bestand zwischen 1941 und 1944. Während der Kontrolle des Gebiets durch die rumänischen Behörden waren nationalsozialistische Einheiten in Odessa und Umgebung vor Ort.
Das belagerte Odessa
Bevor die Frontlinien die Außenbezirke von Odessa erreichten, nutzten einige Zivilisten die Gelegenheit, aus der Stadt zu fliehen. Andere beschlossen, in Odessa zu bleiben, weil sie glaubten, dass die Sowjets die Kontrolle über das Gebiet behalten würden. Wieder andere konnten aufgrund persönlicher Umstände, oder weil sie keine offizielle Genehmigung der sowjetischen Behörden hatten, die Stadt nicht verlassen.
Nachdem die Achsenmächte Odessa eingekesselt hatten, saß die Zivilbevölkerung in der Falle. Die einzige Möglichkeit für sie, zu entkommen und das von der Sowjetunion kontrollierte Festland zu erreichen, war der Seeweg. Die deutschen Luftangriffe zerstörten jedoch Evakuierungsschiffe, was die Fluchtmöglichkeiten der Bevölkerung weiter einschränkte.
Als die Rumänen Mitte Oktober Odessa besetzten, saßen zwischen 70.000 und 120.000 Juden in der Stadt fest. Einige von ihnen waren Einheimische. Andere waren jüdische Flüchtlinge aus Bessarabien, die vor der Brutalität der Rumänen geflohen waren und in Odessa Zuflucht gesucht hatten.
Der Beginn des Holocausts in Odessa
Die rumänischen Behörden übernahmen am 16. Oktober 1941 die Kontrolle über Odessa. Am nächsten Tag wurden alle Juden aufgefordert, sich registrieren zu lassen. Die Rumänen begannen sofort, die jüdische Bevölkerung in der Stadt und den umliegenden Gebieten zu demütigen, willkürlich zu misshandeln und zu ermorden. Darüber hinaus verbreitete sich die antisemitische NS-Propaganda in der ganzen Stadt.
Am 18. Oktober machten die rumänischen Behörden aus einem Gefängnis in der Fontans'ka Straße und der umliegenden Region eine Inhaftierungsstätte für Juden. Sie bezeichneten dieses Gefängnis als Ghetto oder Lager. Die darin eingesperrten Männer, Frauen und Kinder durften nur ein paar lebensnotwendige Dinge mitbringen. Jüdische Männer waren außerdem gezwungen, in der Stadt Zwangsarbeit zu verrichten.
Die Verfolgung der Juden durch die rumänischen Behörden eskalierte schnell. Einigen Memoiren und Untersuchungen der sowjetischen Behörden zufolge begannen Massengewalt und Massenmorde in der Region Odessa bereits am 19. Oktober. Fest steht jedoch, dass die Gewalt ab dem 22. Oktober erheblich eskalierte.
Der Weg zum Massaker: die Explosion vom 22. Oktober 1941
Am Abend des 22. Oktober 1941 erschütterte eine Explosion das militärische Hauptquartier der Rumänen in Odessa. Bei der Explosion kamen mehr als 60 Menschen ums Leben. Unter den Opfern waren der rumänische General, der die Befehlsgewalt über die Stadt hatte, Mitglieder des rumänischen Militärs, vier deutsche Marineoffiziere und Zivilisten. Wer für die Explosion verantwortlich war, war unklar. Die rumänischen Behörden beschuldigten jedoch Juden und Kommunisten. Diese beiden Gruppen wurden in der antisemitischen und antikommunistischen Propaganda oft fälschlicherweise miteinander in Verbindung gebracht.
Als Reaktion auf die Explosion ordnete der rumänische Diktator Ion Antonescu eine brutale Vergeltungsmaßnahme gegen die Juden und Kommunisten in Odessa an. Die daraus resultierenden Massaker wurden größtenteils von den rumänischen Behörden verübt. Unterstützt wurden sie dabei möglicherweise von einer kleinen Gruppe deutscher SS-Truppen.
Das Massaker an den Juden in Odessa: 22. bis 26. Oktober 1941
Die Explosion am 22. Oktober 1941 war der Auslöser für eine drastische und unmittelbare Zunahme judenfeindlicher Gewalt. Noch am selben Abend begannen die Rumänen damit, Juden und Kommunisten zu hängen. Diese öffentlichen Hinrichtungen wurden bis zum nächsten Tag fortgesetzt. Am Abend des 23. Oktober hatten die rumänischen Behörden insgesamt schätzungsweise 5000 Menschen gehängt, darunter vornehmlich Juden. Am nächsten Tag brachten die rumänischen Behörden Tausende von inhaftierten Juden in das nahe gelegene Dorf Dalnyk. Auf dem Weg dorthin wurden einige Juden von den Rumänen hingerichtet. In Dalnyk angekommen, erschossen rumänische Soldaten zunächst einige Dutzend Juden in Panzergräben. Anschließend sperrten sie die verbliebenen Juden in große Gebäude ein, bei denen es sich um Scheunen, Schuppen oder Lagerhäuser handelte. Diese Gebäude wurden daraufhin von den rumänischen Soldaten mit Maschinengewehren unter Beschuss genommen. Diese Massenerschießung dauerte bis zum nächsten Tag. Irgendwann setzten die Rumänen mehrere der Gebäude in Brand. Die rumänischen Truppen erschossen alle, die versuchten, dem Feuer zu entkommen.
Am 25. Oktober setzten die rumänischen Behörden Sprengstoff ein, um mindestens eines der Gebäude in Dalnyk zu zerstören und die darin befindlichen Personen zu töten. Diese Form der Vergeltung wurde von Antonescu als symbolisches Echo auf die Explosion vom 22. Oktober angeordnet. Wie viele Menschen genau in Dalnyk ermordet wurden, ist nicht bekannt. Experten schätzen, dass es sich um etwa 20.000 Menschen handelte.
Zeugenaussagen zufolge haben die rumänischen Behörden im Oktober vor und während des Massakers in Dalnyk auch an anderen Orten Massaker verübt. In einem Munitionsdepot an der Lustdorf Straße wurden zahlreiche Menschen bei Massenerschießungen getötet. Andere wurden in Artillerielagern bei lebendigem Leibe verbrannt.
Jene Juden, die bei dem Massaker in Dalnyk nicht getötet wurden, wurden in ein neu geschaffenes Ghetto in die Siedlungsgemeinde Slobidka im Norden von Odessa gebracht. Am 25. Oktober waren Schätzungen zufolge insgesamt 25.000 Juden dort eingesperrt. Die Bedingungen in Slobidka waren hart. Die Menschen waren auf engstem Raum zusammengepfercht, hungerten und waren starker Kälte ausgesetzt.
Die Gräueltaten der deutschen Streitkräfte in Odessa (Oktober bis November 1941)
Neben den in Odessa stationierten rumänischen Truppen operierte dort für kurze Zeit das Sonderkommando 11b der deutschen Einsatzgruppe D. Das Sonderkommando 11b blieb vom 17. Oktober bis Mitte November 1941 in Odessa. Am 23. Oktober erschoss die deutsche Einheit eine unbekannte Anzahl von Juden aus dem Gefängnis in der Fontans‘ka Straße. Gegen Ende Oktober führten sie eine weitere, umfangreichere Massenerschießung durch. Bis Mitte November durchkämmte diese Einheit die Stadt routinemäßig nach Juden und richtete sie hin.
Das Sonderkommando 11b soll schätzungsweise zwischen 1000 und 5000 Juden in Odessa ermordet haben.
Der Todesmarsch zum Lager Bogdanowka
Nach dem Massaker im Oktober setzten die rumänischen Behörden ihre gewaltsamen Übergriffe auf die Juden in Odessa fort. Ab dem 27. Oktober brachten rumänische Gendarmen Tausende Juden aus Odessa in das von den Rumänen errichtete Vernichtungslager Bogdanowka. Dieses Lager befand sich etwa 160 Kilometer entfernt im ukrainischen Dorf Bohdaniwka. Wissenschaftler schätzen, dass die Rumänen in den darauffolgenden Wochen insgesamt 25.000 bis 30.000 Juden zwangen, die Reise zu Fuß anzutreten.
Unterwegs litten die Juden unter Nahrungs- und Wassermangel sowie unter der Kälte. Sie mussten außerdem Diebstahl und Gewalt durch Gendarmen und Mitglieder der örtlichen Polizei, die die Konvois begleiteten, über sich ergehen lassen.
Bei der Ankunft im Lager Bogdanowka drängten die rumänischen Behörden die überlebenden Juden in die Schweineställe und Scheunen eines sehr großen staatlichen Bauernhofs (radhosp). Dort wurden auch Juden aus anderen Teilen des Gouvernements Transnistrien sowie aus Bessarabien und der Bukowina festgehalten. Aufgrund der unmenschlichen Bedingungen im Lager Bogdanowka starben Tausende von Juden an Hunger und Krankheiten.
Zwischen dem 21. Dezember 1941 und Mitte Januar 1942 wurden bei Massenerschießungen in Bogdanowka Zehntausende von Juden getötet. Diese Erschießungen fanden sowohl unter rumänischer als auch unter deutscher Aufsicht statt. Einige der Schützen waren Mitglieder der örtlichen deutschstämmigen Milizeinheiten mit dem Namen „Selbstschutz“. Diese Einheiten unterstanden de facto einer SS-Sondereinheit. Andere Todesschützen waren Angehörige einheimischer ukrainischer Polizeieinheiten, die unter der Aufsicht rumänischer Gendarmen operierten. Anschließend verbrannten die Täter die Leichen der Menschen, die sie massakriert hatten. Außerdem wurden zwischen 2000 und 5000 Juden, die zu gebrechlich oder zu alt waren, um zum Ort der Massenerschießung zu gehen, bei lebendigem Leibe verbrannt. Die Plünderung von jüdischem Eigentum war während des Massakers weit verbreitet.
Fast alle Juden, die von Odessa in das Vernichtungslager Bogdanowka zwangsumgesiedelt wurden, starben oder wurden ermordet.
Ein „judenfreies“ Odessa
Auch in den Wochen nach dem Oktobermassaker und dem Zwangsmarsch in das Vernichtungslager Bogdanowka setzten die Rumänen die Juden in Odessa weiterhin willkürlichen Gewaltakten aus. Einigen Berichten von Überlebenden zufolge begannen die Rumänen zu diesem Zeitpunkt von den Juden in Odessa zu verlangen, einen gelben Stern an ihrer Kleidung zu tragen.
Mitte Dezember 1941 schätzten die rumänischen Behörden die Zahl der Juden in Odessa auf etwa 44.000. Ende Dezember beschloss der rumänische Diktator Ion Antonescu, dass Odessa „judenfrei“ werden sollte. Er und andere rumänische Führungsverantwortliche glaubten an den Judäo-Bolschewismus, eine Verschwörungstheorie, in der Juden für den Kommunismus verantwortlich gemacht wurden. Sie sahen die Juden in der Sowjetunion als besonders gefährliche Feinde an. 1941 befürchteten die Rumänen, dass die in Odessa verbliebenen Juden der Roten Armee (dem sowjetischen Militär) dabei helfen würden, die Stadt zurückzuerobern, wenn sie die Gelegenheit dazu bekämen.
Auf Anweisung von Antonescu erließ der Gouverneur von Transnistrien, Gheorghe Alexianu, den Befehl, die verbliebenen Juden in Odessa in die ländlichen Gebiete des Gouvernements Transnistrien zu deportieren.
Am 10. Januar 1942 befahlen die rumänischen Behörden allen Juden, die sich noch in Odessa aufhielten, sich innerhalb von zwei Tagen im Ghetto Slobidka einzufinden. Das Ghetto diente als Sammel- und Durchgangsstation für die Deportation von Juden aus Odessa in andere Teile Transnistriens, vor allem nach Beresiwka.
Deportationen mit dem Zug aus Odessa, 1942
Die rumänischen Behörden fingen an, Juden aus Odessa per Zug in den Rajon Beresiwka zu deportieren, der etwa 90 Kilometer nördlich von Odessa liegt.
Die Razzien und Deportationen wurden von rumänischen Gendarmen und mitunter auch von deutschen Wachleuten von Odessa aus durchgeführt. Sie brachten die Juden vom Ghetto Slobidka oder von anderen Sammelplätzen aus zu einem mehr als 10 Kilometer entfernten Bahnhof. Dort wurden größere Gruppen, die von einigen Dutzend bis zu etwa zweitausend Juden reichten, in Eisenbahnwaggons gepfercht und in die Stadt Beresiwka gebracht. Einige wenige Transporte hatten andere Ziele.
Im Januar und Februar 1942 deportierten die Rumänen mehr als 31.000 Juden aus Odessa. Die Temperaturen lagen weit unter dem Gefrierpunkt und die Menschen waren lebensgefährlichen Bedingungen ausgesetzt. Die Situation wurde durch den weit verbreiteten Diebstahl der Habseligkeiten von Juden, darunter auch ihre Oberbekleidung, weiter verschlimmert. Dadurch erfroren bis zu ein Viertel der Deportierten vor oder während der Reise.
Weitere Deportationen von Juden aus Odessa fanden in kleinerem Umfang von März bis Juni statt. Im April 1942 gab es nur noch 701 registrierte Juden in der Stadt. Am 10. Juni 1942 wurde das Ghetto Slobidka geschlossen. Der letzte Deportationszug verließ Odessa am 23. Juni.
Massaker durch deutschstämmige Milizeinheiten
Nach ihrer Ankunft in Beresiwka brachten rumänische Gendarmen und ukrainische Polizisten einen Großteil der deportierten Juden in behelfsmäßige Lager in Dörfern entlang des Flusses Bug. Viele Juden starben auf dem Weg dorthin.
Oftmals wurden diese Märsche von deutschen Milizen (Selbstschutzeinheiten) abgefangen. Sie sperrten die Juden vorübergehend ein und raubten ihnen alle verbliebenen Wertgegenstände. Anschließend töteten sie sie in Massenerschießungen an Orten im Rajon Beresiwka. Die deutschstämmigen Milizen verübten Dutzende dieser Massaker. Bei den Massenerschießungen wurden jedes Mal zwischen 30 und 1000 Juden ermordet. Die umfangreichsten Operationen fanden zwischen Januar und März 1942 statt. Anschließend verbrannten die Milizionäre die Leichen der Opfer.
Zwischen Januar und Juni 1942 ermordeten deutschstämmige Milizen vor allem im Rajon Beresiwka rund 33.500 Juden, die von den rumänischen Behörden aus Odessa deportiert worden waren.
Das Schicksal der verbliebenen Juden in Odessa
Ende Juni 1942 gab es fast keine registrierten Juden mehr in der Stadt Odessa. Später brachten die Rumänen eine kleine Anzahl von Juden, die meisten von ihnen Handwerker, in die Stadt. Sie wurden als Zwangsarbeiter in staatlichen Werkstätten eingesetzt. Im Januar 1943 lebten 54 jüdische Zwangsarbeiter in Odessa, darunter Männer, Frauen und Kinder.
Schätzungsweise 1000 karäische Familien lebten während der rumänischen Besatzung offen in Odessa. Die Karäer waren eine kleine jüdische Religionsgemeinschaft, deren religiöse Praktiken sich von denen der meisten Juden im Osten Europas unterschieden. Die Nationalsozialisten betrachteten die Karäer als türkischstämmig, verfolgten sie daher nicht gezielt und führten keine Massenmorde an ihnen durch. Die rumänischen Behörden in Transnistrien haben offenbar die gleiche Politik verfolgt.
Darüber hinaus blieb eine unbekannte Anzahl von Juden, die nicht offiziell registriert waren, in Odessa. Diese hielten sich oft versteckt oder lebten unter falschen Identitäten.
Versteckte Juden in Odessa
Während ihrer Besetzung von Odessa töteten oder deportierten die Rumänen fast alle Juden in der Stadt. Einige wenige überlebten in Verstecken. Vera Bakhmutskaia, eine jüdische Odessitin, die mit Hilfe eines nichtjüdischen Familienfreundes in einem Versteck überlebt hatte, erkannte, wie unglaublich es war, dass sie überlebt hatte:
Es gab nur noch sehr wenige von uns [Juden]. Sehr wenige. Als die Rumänen sich zurückzogen [...], ging ich durch die Straßen, und es schien mir, als wäre ich die einzige verbliebene Jüdin in der Stadt.
Einige wenige Juden versteckten sich oder lebten unter vermeintlich nichtjüdischen Identitäten. Versuche, der Deportation und dem sicheren Tod zu entgehen, indem sie sich in der Stadt verstecken, waren schwierig und nur selten erfolgreich. Juden, die versuchten, sich allein zu verstecken, mussten nach Nahrung und Schutz suchen, ohne dabei erwischt zu werden. Nichtjuden, die versuchten, ihnen zu helfen, waren einem großen persönlichen Risiko ausgesetzt. Außerdem war es schwer, heimlich für Unterkunft, Nahrung und Kleidung zu sorgen. Während der gesamten Besatzungszeit wurden sowohl die untergetauchten Juden als auch die Nichtjuden, die ihnen halfen, denunziert.
Gott sei Dank hat niemand herausgefunden [dass ich Jüdin bin ...]. Wenn sie davon erfahren hätten, hätten sie mich sofort denunziert. … [... Aber] es gab [auch] Menschen, die sehr menschlich und sehr nett waren, die uns geholfen haben.
In den Jahrzehnten seit Kriegsende wurden Dutzende von Nichtjuden, die Juden in Odessa geholfen haben, von Yad Vashem offiziell als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt.
Die Folgen der rumänischen Besetzung von Odessa
Im März 1944 zogen sich die Rumänen aus Transnistrien zurück. Von da an stand das Gebiet unter deutscher Kontrolle. Die Rote Armee (das sowjetische Militär) eroberte Odessa am 10. April 1944 von den Deutschen zurück.
Zwei Monate später führten die sowjetischen Behörden eine Registrierung der Einwohner von Odessa durch. Dadurch wurde deutlich, dass die jüdische Gemeinde von den Besatzern dezimiert worden war: von etwa 200.000 im Jahr 1939 auf 2.640 im Jahr 1944.
Während die Rote Armee Gebiete zurückeroberte, untersuchten die sowjetischen Behörden eine Vielzahl von Verbrechen, die von den Besatzern begangen worden waren. So auch Verbrechen an Juden in Odessa und anderen Orten. Die sowjetischen Behörden verwendeten die gefundenen Beweise in Prozessen gegen gefangen genommene Täter der Achsenmächte und einheimische Kollaborateure.
Nach Sturz des Diktators Ion Antonescu wurden in Rumänien Ermittlungen gegen prominente Funktionäre eingeleitet. Der ehemalige Gouverneur von Transnistrien, Gheorghe Alexianu, wurde vom Volkstribunal in Bukarest für schuldig befunden. Er wurde am 1. Juni 1946 vom rumänischen Volk für eine Reihe von Verbrechen hingerichtet, unter anderem für jene, die er an den Juden in Odessa begangen hatte.
Gedenken an den Holocaust in Odessa
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges versuchten Juden in vielen Gemeinden der Sowjetunion, der Ermordung ihrer Familien und Freunde öffentlich zu gedenken. Die sowjetischen Behörden widersetzten sich jedoch im Allgemeinen den Bemühungen, einer bestimmten Gruppe von Opfern besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn das sowjetische Regime Denkmäler zum Gedenken an die Toten errichtete, enthielten diese Widmungen mit Formulierungen wie „friedliche Zivilisten“, „Sowjetbürger“ oder „Sowjetvolk“. Dies war auch dann der Fall, wenn die Opfer an einem bestimmten Ort vornehmlich Juden waren. Durch diese Wortwahl wurde das ganze Ausmaß der Tragödie verschleiert, die heute als Holocaust bekannt ist. Dennoch gelang es einigen jüdischen Gemeinden, dank Beziehungen zu sowjetischen Funktionären und informeller Vereinbarungen oder im Zuge von Tauschvereinbarungen Gedenkstätten zu errichten. Doch in Odessa scheiterten die Bemühungen um ein Denkmal während der Sowjetzeit jahrzehntelang.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 entstanden unabhängige Staaten, und die Beschränkungen der Sowjetzeit in Bezug auf Gedenkstätten wurden irrelevant. Dadurch ergaben sich neue Möglichkeiten, an den Holocaust und andere Massengräuel zu erinnern. Seit den 1990er Jahren sind in der gesamten Region zahlreiche Denkmäler für die Opfer des Holocaust entstanden – so auch in der Ukraine.
In und um Odessa finden sich an mehreren Stellen Monumente oder Gedenktafeln für die Opfer des Holocaust. Zu diesen Standorten gehören Dalnyk, Slobidka und das Gelände der ehemaligen Artillerielager an der Lustdorf Straße. Auch im ehemaligen Vernichtungslager Bogdanowka und an anderen Schauplätzen von Massenvernichtung befinden sich Gedenkstätten. 2009 wurde in Odessa ein Holocaustmuseum eröffnet.
Seit 2004 werden Menschen, die den Juden in Odessa während des Krieges geholfen haben, mit einer „Allee der Gerechten“ auf dem Prokhorovskyi Platz geehrt. Der Platz ist von Bäumen gesäumt, und auf einer Tafel sind die Namen derjenigen aufgeführt, die von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wurden.
Fußnoten
-
Footnote reference1.
Die Selbstschutzeinheiten waren Milizeinheiten, die von einer speziellen deutschen SS-Formation (Sonderkommando Russland) geschaffen wurden. Ab August 1942 war diese SS-Einheit auf Grundlage eines formellen Abkommens mit den rumänischen Besatzungsbehörden offiziell für die Selbstschutzeinheiten zuständig. Vor diesem Abkommen waren die Zuständigkeiten weniger klar geregelt; fest steht jedoch, dass diese Milizen in der Praxis von der SS kontrolliert wurden.
-
Footnote reference2.
Interview mit Vera Bakhmutskaia, Visual History Archive, USC Shoah Foundation, 17. Mai 1998, Segment 54; 23:38.
-
Footnote reference3.
Interview mit Vera Bakhmutskaia, Visual History Archive, USC Shoah Foundation, 17. Mai 1998, Segment 54; 23:10.